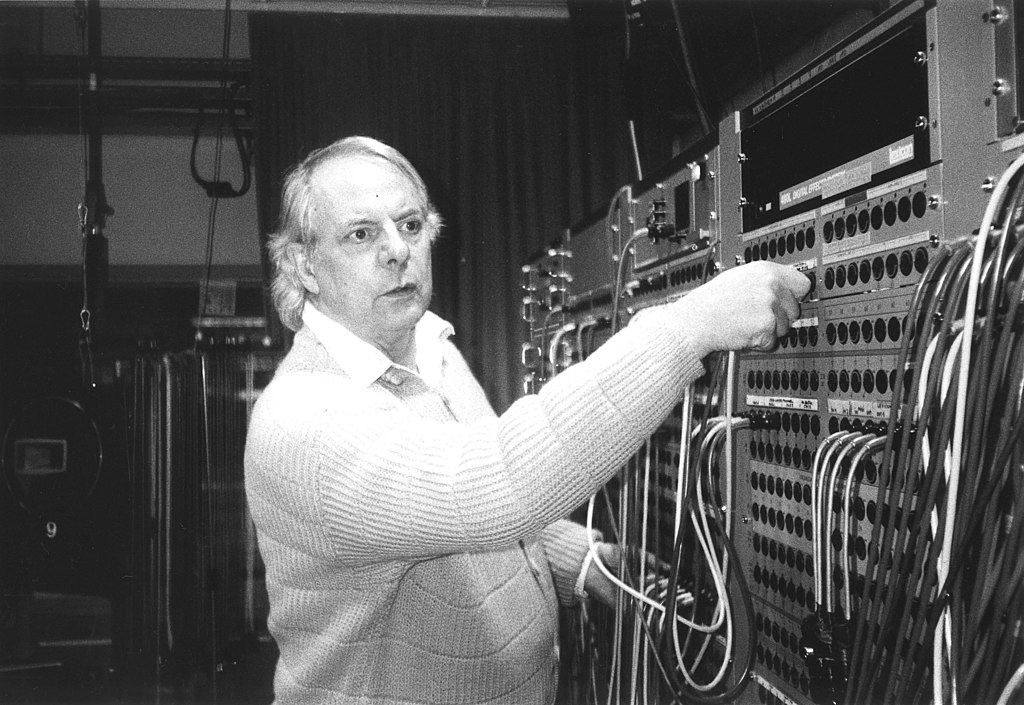Chaussons «Trotz-Trio»
Nach einer Enttäuschung im akademischen Musikbetrieb kam Ernest Chausson zu seiner Patin ins Pays d’Enhaut, wo er sein Klaviertrios op. 3 komponierte.

Die Spuren von Ernest Chaussons Klaviertrio (1881) führen in die Schweiz: Der 26-jährige Komponist, der nach seiner erfolglosen Bewerbung um den Prix de Rome allen akademischen Institutionen von Paris verbittert den Rücken gekehrt hatte, verbrachte den Sommer auf dem Landsitz seiner Mentorin Berthe de Rayssac in Montbovon, Kanton Fribourg. Dort, im male-rischen Pays d’Enhaut, begann er gleich nach seiner Ankunft mit der Skizzierung und Ausar-beitung seiner bisher umfangreichsten und ambitioniertesten Komposition. Es mag sich auch um eine Trotzreaktion auf die zuvor erlittene Niederlage handeln. Chausson fand in diesem Opus 3 zu sich selber als Komponist, und es ist ein Glück, dass er sich keinen akademischen Regeln mehr unterwarf und sich durch die vorerst ausgebliebene Anerkennung nicht entmuti-gen liess. In der Folge zeigte er sein Trio allerdings César Franck und Emanuel Chabrier, spielte es auch dem Maler Odilon Redon vor und beherzigte deren Ratschläge. Im April 1882 kam das Werk zur Uraufführung in einem Konzert der Société nationale de musique, erschien dann aber erst 1919, zwanzig Jahre nach dem frühen und tragischen Tod des Komponisten, als Erstdruck im Pariser Verlag Rouart-Lerolle.
Das 30-minütige Werk mit seinen vier Sätzen wirkt erstaunlich kurzweilig, im Gegensatz etwa zu Chaussons berühmterem «Konzert» für Klavier Violine und Streichquartett op. 21, welches bei seinen 45 Minuten doch einige Längen aufweist. Das satzübergreifende Zitieren von Themen in der Art von Leitmotiven im Klaviertrio op. 3, aber auch die Harmonik erin-nern an Chaussons Vorbilder César Franck und Richard Wagner. Seine Tonsprache weist aber auch bereits auf die folgende Komponistengeneration hin, vor allem auf Claude Debussy. In der französischen Musik nimmt Ernest Chausson einen wichtigen Platz ein!
Die neue Henle-Edition dieses Klaviertrios basiert hauptsächlich auf dem Erstdruck von 1919, weil weitere Quellen fehlen. Autograf ist keines mehr vorhanden, nur einige Skizzen zu The-men und Gliederungsmodellen. Das Notenmaterial von Henle ist wie immer gut lesbar, prak-tikabel bei den Wendestellen und enthält in jeder Stimme sogar einen Dictionnaire (franzö-sisch/deutsch und französisch/englisch) der originalen französischen Vortrags- und Tempobe-zeichnungen. Ausgesprochen nützlich ist auch die Angabe der Taktgliederung im «Vite» überschriebenen zweiten Satz im schnellen 3/8-Takt: Dort wird der erste Takt einer Zählein-heit immer mit einer Eins angegeben. Dies erleichtert das Einstudieren enorm! Die Klavier-stimme wurde von Klaus Schilde mit Fingersätzen versehen, die Streicherstimmen enthalten keine technischen Angaben. Die gedruckten Phrasierungsbogen können aber weitgehend als bogentechnische Realisierung übernommen werden.
Ernest Chausson: Klaviertrio g-moll op. 3 für Violine, Violoncello und Klavier, hg. von Peter Jost, Partitur und Stimmen, HN 1277, € 29.00, G. Henle Verlag, München 2016