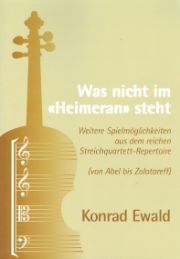Von Abel bis Zolotareff
Spielmöglichkeiten für Streichquartett jenseits der hundert gängigen Werke finden sich im neuen Buch von Konrad Ewald.

Wie schon das Handbuch Musik für Bratsche. Das reiche Repertoire von Aaltonen bis Zytowitsch, dessen vierte Fassung 2013 erschien, ist auch das jetzt der Musik für Streichquartett gewidmete und ebenfalls selber herausgegebene Werk eine Sammlung von sehr persönlichen Erfahrungen und Empfehlungen. Der Gymnasiallehrer Konrad Ewald wirkte als Geiger und Bratschist bereits mit siebzehn Jahren in einem örtlichen Orchester mit. Später gehörte der äusserst entdeckungsfreudige Amateur mehreren Streichquartetten an, wobei er in sechs Jahrzehnten an die 1000 Werke von annähernd 400 Komponistinnen und Komponisten spielte.
Der Hauptteil des mit Titelblättern von Partituren illustrierten Buches erweist sich als eigenwilliger Führer durch die wenig bekannte Quartettliteratur. Einleitend bemerkt der Autor zu den kommentierten Werken: «Dass sie unbekannt sind, hat nichts mit ihnen zu tun, sondern mit uns. Wir kennen sie nicht. Alle haben uns etwas geschenkt (oder schenken wollen), wir haben es nicht zur Kenntnis genommen.» Zum Schreiben angeregt wurde Ewald durch die Frage: «Warum spielen die meisten Streichquartett-Formationen stets nur dieselben 100 Werke von bloss 20 Komponisten?»
Der Buchtitel bezieht sich auf das erstmals 1936 erschienene Standardwerk Das stillvergnüge Streichquartett von Ernst Heimeran, das seit der 17. Auflage von 1969 neu formulierte Werkbesprechungen von Bruno Aulich enthält. Ewald untermauert seine Empfehlungen häufig mit Zitaten aus Kammermusikführern von Wilhelm Altmann und aus Friedhelm Krummachers dreibändiger Geschichte des Streichquartetts. Er geht in den alphabetisch geordneten Beiträgen nicht nur auf spieltechnische Probleme und den musikalischen Gehalt der Kompositionen ein, sondern auch auf Neuausgaben längst vergriffener Werke und auf CD-Einspielungen.
Mit seinem fundierten Fachwissen beschämt Ewald viele ahnungslose Kammermusikprofessoren, die weder Entdeckergeist noch Leidenschaft kennen. Besonders viel Spannendes gibt es in den klugen Werkkommentaren zu entdecken, etwa bei Elfrida Andrée, Carl Czerny, beim Schweizer Frühromantiker Friedrich Theodor Fröhlich, bei Friedrich Gernsheim, Louis Théodore Gouvy, Alexander Gretschaninow, Emilie Mayer, bei den Brüdern Lachner, Friedrich Lux, Louis Massonneau, Bernhard Molique, Nikolai Mjaskowski, Ignaz Joseph Pleyel, Carl Gottlieb Reissiger, beim Beethoven-Schüler Ferdinand Ries, bei Anton Rubinstein, Anton Ferdinand Titz und Wenzel Heinrich Veit.
Ewalds Buch lässt jenen unerschöpflichen Reichtum an Quartetten erahnen, welchen Hermann Walther in seinem Verzeichnis des Streichquartetts. Streichquartettkompositionen von 1700 bis heute (Schott, Mainz 2017, vergl. Schweizer Musikzeitung 3/2020, S. 21) mit Werken von über 11 000 Komponistinnen und Komponisten ausbreitet. Wer sich eingehend mit der internationalen Streichquartettmusik beschäftigen will, kommt um beide Bücher nicht herum.
Konrad Ewald: Was nicht im «Heimeran» steht. Weitere Spielmöglichkeiten aus dem reichen Streichquartett-Repertoire (von Abel bis Zolotareff), 224 S., Fr. 36.00, Selbstverlag Konrad Ewald, Liestal 2020, Auslieferung: Schlöhlein GmbH, Basel, ISMN 979-0-50274-999-6