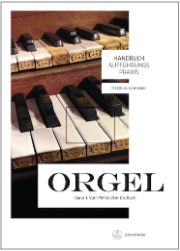Historisch informierte Orgelpraxis
Matthias Schneider ist ein ausgewiesener Buxtehude-Kenner und hat nun ein Buch zur Aufführungspraxis auf der Orgel vom Mittelalter bis Bach verfasst.

Es gibt Fachbücher für Organisten und Orgelliebhaber zuhauf. Jedoch bislang keines, das im Mittelalter beginnt und bis zu J. S. Bach führt. Kein Geringerer als Matthias Schneider, Dozent an der Universität von Greifswald und Leiter von einschlägigen Sommer-Ferienkursen daselbst, hat nun eines verfasst. Es soll in einem zweiten Band weitergeführt werden bis ins 20. Jahrhundert. Nach einer Einleitung über Notationen, historische Fingersätze usw. drehen sich zehn Kapitel um: Mittelalter-Renaissance, norddeutsche Orgeltabulaturen, italienische Musik, Sweelinck und seine Schüler, Samuel Scheidt, Dieterich Buxtehude, süddeutsche, iberische und französische Orgelmusik, schliesslich Bach.
Allen Benutzenden des Buches ist zu empfehlen, es als Nachschlagewerk zu betrachten. Lesen Sie jeweils über den Komponisten, von dem Sie ein Werk erarbeiten. Ein Vorteil von Schneiders Methode: Er äussert sich ausgiebig über wenige ausgewählte Werke. Was Sie hierbei erfahren, können Sie auf andere Werke derselben Gattung anwenden.
Dieterich Buxtehude
Buxtehude ist ein Spezialgebiet Schneiders; er ist einer der beiden Herausgeber der Jahresschrift Buxtehude-Studien. Hier erörtert er den Komponisten auf 27 Seiten.
Buxtehude notierte noch nicht in unserer Notenschrift, sondern in Buchstaben (sog. Tabulaturnotation). Kein einziges Autograf ist erhalten. Die ganz unbefriedigende Quellenlage hat dazu geführt, dass gute und eigenmächtige Notenherausgeber zu stark abweichenden Resultaten gelangt sind. Bei den eigenmächtigen sticht Klaus Beckmann negativ hervor wegen seiner sogenannten «inneren Textkritik». Schneider unterlässt zwar eine Warnung vor diesen Ausgaben; Die Probleme sind z. B. durch Vergleich mit der neuesten und besten Ausgabe von Michael Belotti leicht festzustellen (letztere sind allerdings überaus kostspielig).
Die verbreitetste nicht choralgebundene norddeutsche Form heisst bedeutungsgleich Toccata oder Präludium (jedoch nicht wie später bei Bach und seinen Zeitgenossen Präludium und Fuge). Sie besteht aus einer Anzahl abwechselnd freier und fugierter Abschnitte. Schneider bespricht gründlich auf beinahe 5 Seiten ein einziges Beispiel, nämlich die Toccata in d BuxWV 155 in Bezug auf Taktarten (Tabulaturnotation zeigt keine Taktstriche), die Verteilung auf Pedal (selten mit Ped. bezeichnet) und Manual sowie auf die beiden Hände, auf artikulative Trennung von Motiven, die Freiheit des Überlegato und die Freiheit, Verzierungen verschiedener Art einzufügen. Die Wahl von Registrierungen und Manualwechseln ist Sache der Interpretation. Ob und in welchen Formteilen organo pleno angebracht ist, will bedacht sein. Auf Instrumenten aus der Epoche der «Orgelbewegung», die häufig übertrieben scharf und laut klingen, sollen die Ohren des Publikums nicht strapaziert werden.
Solche Formen wurden zur Zeit Buxtehudes, seiner Vorgänger und Nachfolger in Gottesdiensten und Abendmusiken in der Regel improvisiert. Sind deshalb aufgeschriebene Kompositionen lediglich gedacht als Muster? Erfrischend in Schneiders Darstellung ist das weite Feld der Freiheiten. Wir sehen daraus, dass er nicht nur musikwissenschaftlich korrekt darstellt, sondern aus seiner Erfahrung als Kursleiter schöpft.
Drei ostinate Formen sowie ostinate Teile von Toccaten stellt Schneider in Beispielen zur Diskussion. Choralgebundene Werke erfahren eine ähnlich freie Behandlung. – Schneider beschreibt Buxtehudes Hauptorgel in der Marienkirche von Lübeck, die 1518 entstanden ist, selbstverständlich mitteltönig gestimmt.1561 und 1598 wurde sie vergrössert. Kein Geringerer als der berühmte Orgelbauer Friederich Stellwagen arbeitete seit 1634 selbständig in Lübeck. Bis 1641 dauerte sein Umbau in der Marienkirche. Vermutlich 1684, also während Buxtehudes Amtszeit erhielt sie eine Kompromiss-Stimmung in der Art von Werckmeister-III. Durch diese wurden Tonarten mit vielen Vorzeichen erst möglich. Dies hilft, ganze Kompositionen (z. B. Präludium in fis-Moll BuxWV 146) oder Teile davon (Präludium in C-Dur BuxWV 137 mit H-Dur-Dreiklängen) zu datieren.
Bei den historischen Fingersätzen müsste mit folgenden Einschränkungen gerechnet werden: eine Stimme pro Hand, Tonleiterausschnitte auf- und abwärts, Tonarten mit wenig Gebrauch von Obertasten. Auch für mehrere polyfone Stimmen pro Hand gelten sie nicht. Zudem ist zu bedenken, dass der gesamte Unterricht für Tasteninstrumente auf dem Clavichord erteilt wurde (mit Ausnahme von Frankreichs Clavecinisten im 18. Jahrhundert). Auf dem feinfühligen Clavichord muss jeder Finger die Tasten möglichst ganz vorn niederdrücken. Dies ist auch der Sinn von Tastaturen, bei denen die Untertasten nur 2 bis 2,5 cm über die Obertasten hinausreichen, im Vergleich zu heutigen Klaviertastaturen mit 4,5 cm. Schliesslich sind in den meisten Ländern die «guten» Finger 1 und 3 auf relativen Betonungen zu nehmen, die «schlechten» 2 und 4 relativ unbetont; in Frankreich kehrt sich das um wegen des «jeu inégal».
Johann Sebastian Bach
Ihm widmet der Autor 49 Seiten. Es lohnt sich, Schneiders ausführliche Beschreibung der von Bach im Laufe seines Lebens gespielten Orgeln und die damaligen Registrierungsanweisungen genau zu lesen. Er behandelt z. B. die Angabe «pro organo pleno» vorsichtig und differenziert: Nicht jedes Präludium, jede Fuge erträgt lauten Klang. Schneider hätte grundverschiedene akustische Verhältnisse und die Auswirkungen maritimen und kontinentalen Klimas hinzufügen können: Während in Norddeutschland grosse Kirchen in Backstein-Gotik mit langem Nachhall vorherrschten, hatten Kirchen in Bachs thüringischer Heimat viele Holzeinbauten, also kurzen Nachhall. So konnte Bach schnelle harmonische Wechsel komponieren, ohne für die Gemeinde unverständlich zu werden. Das Klima hat gravierende Folgen für die Orgeldispositionen: in Norddeutschland viele Zungen, in Mitteldeutschland nur wenige und als Zungenersatz terzhaltige Mixturen. Grundsätzlich gilt auch heute noch: bei langem Nachhall langsam spielen und möglichst wenige und nur leise Register ziehen.
Viele Orgeln besassen zu Bachs Zeit in der grossen Oktave keine vollständige chromatische Reihe. Schneider bespricht in allen Teilen seines Buches die sogenannte «kurze Oktave», die «gebrochene Oktave» und das fast überall fehlende Cis. Einzig die Schlosskirche von Weimar besass Cis in den zwei Manualen und im Pedal (entgegen der unzutreffenden Darstellung durch Hermann J. Busch, korrigiert durch Jean-Claude Zehnder). Bach weilte ab Januar 1703 während 6 Monaten in Weimar, angestellt am Hof als «Laquey». Im vorletzten Stück der Partitenreihe über Ach, was soll ich Sünder machen BWV 770 kommt einmal in der linken Hand das verräterische Cis vor. Dies erlaubt, das Werk in diese Zeit zu datieren. Schneider diskutiert verdientermassen ausführlich dieses entzückend jugendfrische Werk.
Viele Orgelwerke Bachs entstanden während seiner Weimarer Zeit: das Orgelbüchlein, die 17 grossen Choralbearbeitungen (nach 1740 geringfügig revidiert als Leipziger Choräle bezeichnet), mehr als die Hälfte seiner Präludien und Fugen und die Concerto-Bearbeitungen nach Vivaldis L’estro armonico op. 3. Jede Gattung wird in wenigen Beispielen genau besprochen. Drei Präludien fehlen: A-Dur BWV 536, f-Moll BWV 534 und c-Moll BWV 546. Bei deren Fugen wurde die Autorschaft Bachs von David Humphreys und Peter Williams bezweifelt. Ich konnte jedoch nachweisen, dass sie lange vorher entstanden sind und dass die Fuge in A-Dur manualiter zu spielen ist, wobei das Pedal erst kurz vor Schluss dazu kommt (in: The Organ Yearbook 2008).
Sicher richtig schreibt Schneider bei den 6 kammermusikalischen Triosonaten BWV 525–530, für den ältesten Sohn Wilhelm Friedemann komponiert, dass pro Stimme ein Register genüge, dass zur bequemeren Spielbarkeit die linke Hand mit Vierfuss eine Oktave tiefer gegriffen werden könne und vor allem, dass für das Pedal ein Sechzehnfuss überflüssig sei. Schneider hätte hier noch die Kantaten mit obligater Orgel aus dem Jahreszyklus 1726/27 erwähnen können, ebenfalls für Wilhelm Friedemann geschrieben, bevor dieser Leipzig verliess.
Was in einer zweiten Auflage dieses zukunftsträchtigen Handbuches zu ergänzen wäre: Fälle von Temporelationen in der «proportio sesquialtera». Genannt seien nur zwei eindrückliche Beispiele: Präludium und Fuge in a-Moll BWV 543. Die Viertel des gemessen schreitenden, mit vielen Dissonanzen befrachteten Präludiums nehmen den gleichen Zeitraum ein wie drei Achtel in der alerten Fuge. Umgekehrt verhalten sich Präludium und Fuge in G-Dur BWV 541: ganze Takte im gleichen Zeitraum wie halbe Takte der Fuge. Nur so entfaltet das Präludium mit der Beischrift Vivace die notwendige Spritzigkeit, ohne stark übertriebenes Tempo in der anspruchsvollen Fuge.
Matthias Schneider: Handbuch Aufführungspraxis Orgel, Band 1: Vom Mittelalter bis Bach. 267 S. geb. € 49.95, Bärenreiter, Kassel 2019, ISBN 978-3-7618-2338-5