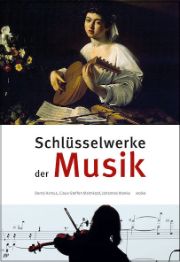Ein Kanon von Meisterstücken?
268 Schlüsselwerke von 180 Komponistinnen und Komponisten werden in diesem Buch vorgestellt. Die Auswahlkriterien bleiben aber diffus.

Schlüsselwerke: Das sind einerseits Stücke, die einer Epoche etwas Neues erschliessen, so dass alles anders ist als zuvor. Es sind andererseits Stücke, die uns im Nachhinein eine Epoche zugänglich machen, so dass wir sie besser verstehen. Welche Stücke wären das nun? Auf einige von ihnen, L’Orfeo, die Neunte oder den Wozzeck etwa, wird man sich leicht einigen können, aber dann beginnt die Diskussion. Und natürlich wählen jeder und jede anders aus!
Und deshalb weckt schon ein erster Blick ins Inhaltsverzeichnis dieses Buchs Zweifel. Von Chopin, Ravel oder Cage gerade ein Stück? Kein Antoine Brumel, Gottfried Heinrich Stölzel oder Pierre Henry, dafür ein Klavierkonzert von Norbert Burgmüller oder Guillaume Lekeus Klavierquartett? Und ist Glenn Goulds Interpretation der Goldberg-Variationen als Werk zu verstehen? Noch schwieriger wird es, wenn sich die Autoren nicht für ein Werk entscheiden können. So wählen sie gerade je eine Sinfonie von Haydn und Mozart aus, packen jedoch alle neun von Beethoven auf eine Seite und alle seine Klaviersonaten auf eine halbe. Ein Kanon lässt sich so nicht bilden.
Vielleicht sollte man ein Buch mit «Schlüsselwerken der Musik» nicht als Bestätigung eigener Meinungen verstehen, sondern als Herausforderung annehmen. Und das ist es denn auch: 268 Schlüsselwerke von 180 Komponistinnen und Komponisten vom anonymen Mittelalter wie ins frühe 21. Jahrhundert sind hier versammelt und exemplarisch besprochen. Allerdings handelt es sich oft kaum um Werk-, sondern um Komponistenporträts, ausgehend von einem Werk. Auch das zeugt von einer gewissen Unentschlossenheit gegenüber dem «Schlüsselwerk».
Zugänglichkeit und Verständlichkeit sind Programm: Klassische Musik sei heute nichts Elitäres mehr, sondern leicht greifbar, behaupten die Autoren zu Beginn des Vorworts, und sie lösen es dadurch ein, dass sie versuchen, sich nicht fachterminologisch zu verstricken. Zuweilen glückt es ihnen, kleine Geschichten zu erzählen. Sie dekonstruieren Klischees – und bauen anekdotisch gleich selber welche auf. Die Sprache enthält streckenweise Witz und willkommene Ironie, gerät aber manchmal etwas gar flapsig, etwa wenn es über Witold Lutosławskis Jeux vénitiens abschliessend heisst: «Die vier Kurzsätze sind ungemein lebendig, vor allem der letzte. Die Lagunenstadt dürfte sich darin wiederfinden.» Was soll das? So hinterlässt das Buch trotz vieler Anregungen und Informationen auch einen etwas zwiespältigen Eindruck. Eine klarere Konzeption hätte da geholfen.
Bernd Asmus, Claus-Steffen Mahnkopf, Johannes Menke: Schlüsselwerke der Musik, 304 S., € 26.80, Wolke, Hofheim 2019, ISBN 978-3-95593-125-4