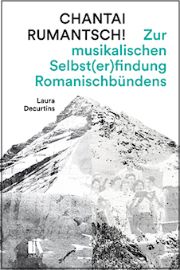Die musikalische DNA Romanischbündens
In ihrer umfangreichen Dissertation hat Laura Decurtins die Geschichte des rätoromanischen Musikschaffens mit der Identitätsfindung der romanisch sprechenden Bevölkerung verbunden.
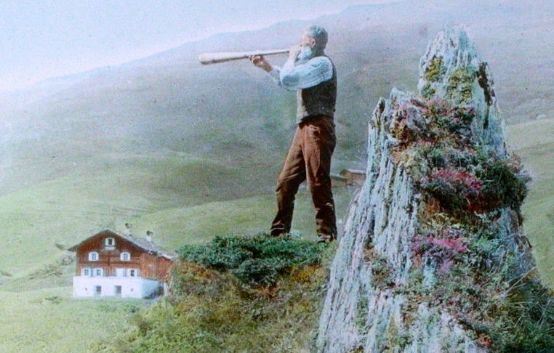
Es ist ein mutiges und verdienstvolles Ziel, das sich die Bündner Musikwissenschaftlerin Laura Decurtins gesetzt hat: «Ich möchte gewissermassen die ‹musikalische DNA› Romanischbündens erforschen und eine musikalische Sicht auf Romanischbünden bieten.» Dank eines Forschungsprojektes der Universität Zürich und des Instituts für Kulturforschung Graubünden bekam sie Zeit und Geld für ihr Vorhaben, und seit Kurzem ist das Resultat ihrer umfangreichen Forschungen als Buch im Chronos-Verlag unter dem Titel Chantai rumantsch! – Zur musikalischen Selbst(er)findung Romanischbündens erhältlich.
Das Buch ist dick und schwer, der Inhalt wurde 2017 von der Universität Zürich als Dissertation angenommen: keine Ingredienzen für eine leichte Lektüre. Und die Befürchtungen des Rezensenten bewahrheiten sich. Es braucht Disziplin und Zeit, um der mit über 500 Seiten umfangreichen Arbeit von Laura Decurtins gerecht zu werden. Eine etwas holprige Sprache, viele Quellenverweise – allein der Quellennachweis benötigt über 40 Seiten – und immer wieder unübersichtliche Namensnennungen machen den Text nicht zugänglicher. Doch die Arbeit wird belohnt.
Laura Decurtins verknüpft die Geschichte des rätoromanischen Musikschaffens mit der Identitätsfindung der romanisch sprechenden Bevölkerung. «Musica rumantscha» bedeute daher nicht nur «Musik zu Texten in bündnerromanischer Sprache», sondern vielmehr «Musik von, durch, mit und für Bündnerromanen». Musik als Teil der kulturellen Identität und damit prägend für eine Gesellschaft ist kein neuer Gedanke, wurde aber lange von der Musikwissenschaft vernachlässigt.
Die Autorin hat ihr Buch in fünf Hauptkapitel unterteilt. Es beginnt mit der frühen Neuzeit und dem Geistlichen Gesang, geht weiter zum Patriotischen Gesang und Heimatbewusstsein im 19. Jahrhundert, dann zum Chorgesang und Sprachbewusstsein in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts und zur populären Vokalmusik und neuem Kulturbewusstsein in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Es endet mit dem Kapitel zur sprachlich-kulturellen Identitätsfindung in der aktuellen Vokalmusik. Während der Lektüre wird deutlich, wie fragmentiert und kleinräumig der Kulturraum der romanisch sprechenden Bevölkerung in Graubünden war und immer noch ist. Als Vertreter der deutschsprachigen Bündner Mehrheit übersieht man das schnell. Auch die jahrhundertealte Vorherrschaft des Deutschen als Amtssprache und der Wandel des Rätoromanischen von der Umgangssprache zur Schriftsprache und wie dies mit dem musikalischen Schaffen verknüpft ist, wird anschaulich beschrieben. So ist bereits der Einstieg mit den Ausführungen, wie, von wem und wann geistliche Texte und Lieder auf Romanisch übersetzt wurden und wie sie verbreitet wurden, höchst interessant. Ein besonderes Verdienst ist auch, dass sich Laura Decurtins mit der zeitgenössischen Musik auseinandersetzt. Damit werden die vorhandenen Bezüge deutlich, die die rätoromanische Musik von der frühen Neuzeit bis in die Gegenwart aufweist.
Laura Decurtins hat ein detailliertes und fundiertes Nachschlagewerk zur Entwicklung und Geschichte der rätoromanischen Kultur erarbeitet. Diese Geschichtsschreibung hat erst begonnen und wird hoffentlich Nachahmer finden. Denn fallen bei den ersten vier Kapiteln die Sorgfalt und das analytische Vorgehen auf, gerät das letzte Kapitel zur Gegenwart allzu stark zu einer Auflistung von Biografien aktiver Musikerinnen und Musiker sowie Institutionen, die allerdings nicht vollständig ist und auch nicht reflektiert wird. Das ist etwas schade, denn damit bleibt die Frage, wie sich die rätoromanische Musik und ihre Akteure im internationalen Umfeld behaupten und entwickeln, immer noch offen. Wir sind gespannt auf die Fortsetzung.
Laura Decurtins: Chantai rumantsch! Zur musikalischen Selbst(er)findung Romanischbündens,
564 S., 57 Abb., Fr. 58.00, Chronos, Zürich 2019, ISBN 978-3-0340-1501-1
E-Book (PDF) kostenlos