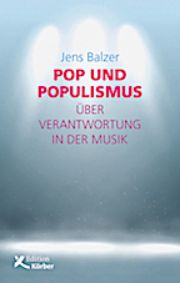Skandale oder Skandälchen?
In «Pop und Populismus» analysiert Jens Balzer Songtexte, die, wie er findet, parallel zur Politik provokanter und aggressiver werden. Der Rezensent stimmt dieser Analyse nur bedingt zu.

Interessant sind die Fragen schon: Wie viel Verantwortung hat ein Rockmusiker? Wann erreicht er oder sie die Grenze, wo Provokation übergeht in Tabuzonen, in so genannte «No-Gos»? Seit jeher tummeln sich Rock- und Popmusiker in prekären Gefilden – seien es offen zur Schau gestellte Sexfantasien (Rammstein beredt: Bück Dich) oder düstere Gewaltszenerien mit Bezügen zum Dritten Reich (Slayer: Angel of Death). Nur sind nicht alle Textzeilen für bare Münze zu nehmen. Manches ist – siehe Rammstein – ironisch gebrochen, manch anderem ist – siehe Slayer – jener Skandal bewusst eingeschrieben und nicht unbedingt politisch motiviert, sondern bloss verkaufsfördernd. Ein grosser Aufschrei ist Werbung. Er weckt Interesse.
Auf einen Nenner bringen lassen sich die vielen Pop- und Rock-Erscheinungen kaum. Insofern tut der Autor und Pop-Kritiker Jens Balzer gut daran, von einigen ausgewählten Beispielen auszugehen. Da wären zum Beispiel jene Rapper, die Spätpubertierende im Blick haben. «Jung, brutal, gutaussehend xxx» schrieben sich die Rapper Kollegah und Farid Bang auf die Fahnen. Ihre Texte strotzen von Sex, von Gewalt, auch von Antisemitismus, was zum Echo-Skandal führte. «Mein Körper definierter als von Auschwitzinsassen», heisst es im Song 0815. Andernorts rappen sie: «Mache wieder mal ’nen Holocaust, komm‘ an mit dem Molotow.»
Ob so etwas mit dem Begriff künstlerischer Freiheit gerechtfertigt wird, bleibt zweifelhaft. Für Balzer jedenfalls sind solche Verfehlungen ein Indiz für die Verrohung der Sitten. Er sieht klare Parallelen von Musik und heutiger Politik, wo Syrer, Moslems oder Juden ins verbale Fadenkreuz kommen. Verantwortung des Pop hiesse für Balzer: eine bewusste Gegenreaktion auf die neue Rechte im Sinne intelligenter Texte ohne Phrasen, ohne Schlagwörter à la Kollegah. Und durchaus auch eine politisch korrekte Sprache, wie er sie im Fall des englischen Performance-Künstlers Planningtorock beschreibt, die sich dem Andersartigen, dem Fremden öffnet im Sinne differenzierter Transgender-Betrachtungen. «Es geht», so Balzer resümierend, «um die durch nichts zu ersetzende Hoffnung, dass der Pop uns Orte und Räume, Momente und Möglichkeiten zu schenken vermag, in denen Menschen, die vielleicht ganz anders sind als wir selber, uns nicht als Konkurrenten und Gegner begegnen, sondern als Freundinnen und Freunde.»
Das rund 200-seitige Buch Pop und Populismus regt schon zum Denken an. Es ist jedoch fraglich, ob der Mantel des Schweigens nicht die bessere Alternative wäre als eine Kritik, die im Fall wenig intellektueller Rapper leichtfällt, aber letztlich ins Leere zielt. Pop als Massenphänomen ist per se meist oberflächlich bis hochnotpeinlich. Ähnliches gilt in der Tat für rechte Politik. Dortige Texte sind auch «gefühlig» – aber weitaus gefährlicher als Musik für Teenies, die einfach nur stark sein wollen.
Jens Balzer: Pop und Populismus. Über Verantwortung in der Musik, 206 S., € 17.00, Edition Körber, Hamburg 2019, ISBN 978-3-89684-272-5