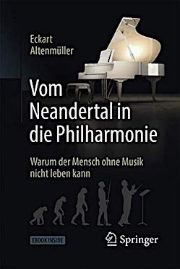Wie wirkt Musik?
Eckart Altenmüller beleuchtet in seinem Buch «Vom Neandertal in die Philharmonie – Warum der Mensch ohne Musik nicht leben kann» mit grossem Geschick die physiologischen Aspekte des Musizierens.
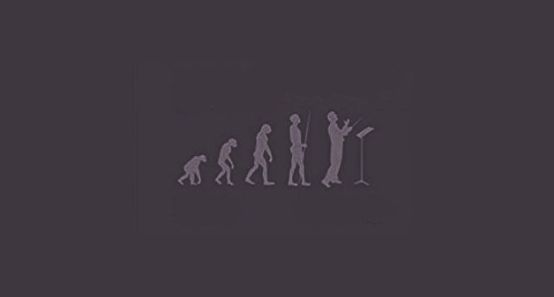
Warum noch ein Buch über Musik und Gehirn?, fragt sich Eckart Altenmüller gleich als erstes. Es unterscheide sich von anderen, antwortet er selber, weil er auch Fragen nach dem Woher, Wie und Warum stelle. Das Feld steckt er denn auch weit ab, mit Einblicken in die Forschungen zur Urgeschichte des Musizierens, zur Frage, ob Tiere auch Musizieren, zur Emotionsforschung und zur Musiktherapie. All dies tut er in einem wohltuend unprätentiösen, klaren und fundierten Stil. Ergänzt werden die Ausführungen im Fliesstext durch Musikbeispiele, die mit Hilfe von QR-Codes abgerufen werden können.
Altenmüller ist Neurologe und als Flötist Schüler von Aurèle Nicolet, das heisst, sowohl als Musiker wie auch als Wissenschaftler äusserst beschlagen. Er gilt zu Recht weltweit als einer der bedeutendsten Vertreter der Neuromusikologie. Dass die Lektüre des Buches zum grossen Vergnügen wird, ist überdies der Tatsache zuzuschreiben, dass er als Person präsent bleibt. Thesen und Theorien illustriert er vorzugsweise aus seinem persönlichen Erfahrungshintergrund als Flötist. Zahlreiche Beispiele hat er denn auch selber auf seinem Instrument eingespielt. Gut spürbar ist überdies seine Verwurzelung in der westeuropäischen, bildungsbürgerlichen Medizintradition. Einschübe zur Auflockerung der wissenschaftlichen Darlegungen zitieren Persönlichkeiten wie Grimmelshausen, Proust, Ingeborg Bachmann, Ovid und so weiter.
Die stärksten Passagen des Buches stellen die Darlegungen zu physiologischen Aspekten des Musizierens dar. Altenmüller versteht es nicht nur, neuere Resultate zu Hirnphysiologie und Sensomotrik des Musizierens nahezubringen. Auch Übetechniken und Musikerkrankheiten, vor allem den «Musikerkrampf», handelt er erhellend ab. Etwas mehr aufs Glatteis gerät er, wenn es um die eher geisteswissenschaftlichen Gebiete der Emotionstheorien und Musiktherapie geht. Grossen Raum nehmen dabei wiederum die eher physiologischen Forschungen zu Gänsehautmomenten in der Musik ein. Wie Altenmüller selber einräumt, werden solche durch eher banale Dinge wie ein Kratzen auf einer Wandtafel zuverlässiger erzeugt. Man kann sich also fragen, wie gross ihr Erkenntnispotenzial für die Emotionsforschung in der Musik tatsächlich ist.
Wichtige aktuelle Modelle der Emotionsforschung in der Musik bleiben hingegen unerwähnt oder werden bloss am Rande gestreift. Vermissen dürfte man etwa Hinweise auf das ethologische Modell David Hurons oder auf Klaus R. Scherers Komponentenprozessmodell und auf die Emotionstheorien Nico Frijdas, die Ausgangspunkt für die wichtigsten neueren Modelle sind. Auch die Musiktherapie reflektiert Altenmüller vor allem als Physiologe. Einige Beispiele zur aktuellen Musiktherapieforschung scheinen wenig repräsentativ oder überholt.
Eckart Altenmüller: Vom Neandertal in die Philharmonie – Warum der Mensch ohne Musik nicht leben kann, 511 S., € 24.99, Springer, Berlin 2018, ISBN 978-3-8274-1681-0