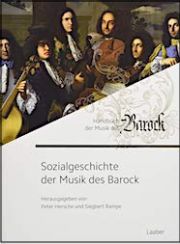Musikeralltag im Barock
Unter welchen sozialen Bedingungen arbeiteten Musiker in jener Zeit? – Ein längst fälliges, überaus informatives, wenn auch etwas vorsichtiges Buch gibt Antwort.

Gedruckte Musiknoten waren einst teuer. Nicht jeder konnte sie sich leisten. Deshalb hätte sich ein Musiker auf dem Lande zum Beispiel statt der Druckausgabe des Musicalischen Opfers eine Kopie gekauft und dafür statt einem Reichstaler nur acht Groschen hingelegt. (Und wieviel bekam davon in einer Zeit ohne Suisa und Pro Litteris der Komponist?) Noch billiger (etwa fünf Groschen) wäre es gewesen, die Noten selber abzuschreiben. Das lohnte sich, wenn man bedenkt, dass ein angestellter Musiker rund acht Taler monatlich für sich und seine Familie zur Verfügung hatte.
Erhellende Details wie diese aus dem Musikeralltag finden sich allemal in dieser Sozialgeschichte der Barockmusik. Auf ungemein spannende Weise führt sie uns in die Niederungen der Praxis. Mehrere Autorinnen und Autoren sind daran beteiligt, den Hauptharst aber haben die beiden Herausgeber Peter Hersche und Siegbert Rampe beigetragen: zur wirtschaftlichen Lage und gesellschaftlichen Ordnung jener Zeit, was sich für eine so heterogene, sich weiterentwickelnde Epoche gar nicht leicht zusammenfassen und noch weniger verallgemeinern lässt. Die Dinge waren im Fluss. Wo also fand Musik statt und wer führte sie auf? Welchen Status hatten die Musiker und welchen ihre Instrumente? Wer baute sie? Wer bildete darauf aus? Was konnte sich ein Musiker tatsächlich von seinem Salär leisten: ein Gärtchen, eine Bibliothek, eine Magd für die Gattin? Der Fragen sind viele.
Und weil es so gar nicht emphatisch um Kunst geht, sondern eher um die Umstände, unter denen sie entsteht, und dabei gerade auch ums Geld, wird das Thema nüchtern und klar ausgebreitet. Der Blick richtet sich vor allem auf die Verhältnisse im deutschsprachigen Raum, und wird daher nach aussen hin etwas unschärfer. Dabei wird auch nicht verschwiegen, dass wir eigentlich viel zu wenig wissen. Die Musikwissenschaft hat sich lange kaum um diese Sozialgeschichte gekümmert. Bemitleidet wurde Bach, wenn er um Gehaltsverbesserung bat, aber dass das fast den ganzen Musikerstand betraf, ging dabei unter. Vielleicht ist dies auch der Grund, dass sich die Autoren mit ihren Erkenntnissen nicht weiter vorwagen, in die Anekdote, gar in die Spekulation hinein. Insgesamt ist das Buch ungemein informativ und auch mit vielen Beispielen illustriert, aber nicht so recht mit dem prallen Leben gefüllt. Das ist vielleicht sogar ein Vorteil, weil es nichts verschleiert. Es führt uns den nackten Alltag vor Augen.
Sozialgeschichte der Musik des Barock, hg. von Peter Hersche und Siegbert Rampe, (Handbuch der Musik des Barock 6), 400 S., ill., geb., € 108.00, Laaber-Verlag, Laaber 2017, ISBN 978-3-89007-875-5