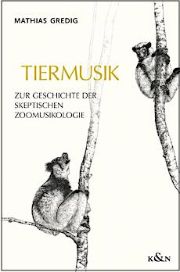Über Tiermusik
Mathias Gredig rollt kulturhistorische und philosophische Fragen auf rund um eine Musik der Tiere vom Alten Ägypten bis ins 19. Jahrhundert.

Es ist ein ungemein gescheites Buch, gerade auch weil es der eigenen Gescheitheit kritisch gegenübersteht. Kaum vorstellbar, was für ein Wissen Mathias Gredig zum Thema Tiermusik zusammenträgt und doch bleibt er dabei skeptisch, methodisch getragen von der alles anzweifelnden, pyrrhonischen Skepsis der Antike: Können wir überhaupt sagen, ob Tiere Musik machen? Schliesslich müssten das ja die Tiere wissen. Was sich wohl die den Ägyptern heiligen Paviane dachten, wenn sie mit ihrem Geschrei/Gesang die Sonne begrüssten?
Mindestens so interessant ist freilich, wie sich die Menschen zu den Tieren und deren Musik verhielten. Dass Nachtigallen wunderschön singen, war allen klar, aber machen sie Kunstmusik? Nein, sagt Augustinus, weil sie nichts von den Zahlenverhältnissen und Intervallen verstünden. Seltsame Argumentation, aber durchaus typisch für Philosophen. «Darauf könnte einiges entgegnet werden», meint Gredig dazu vielsagend.
Das eine Beispiel zeigt schon, wie widersprüchlich und vielfältig unser menschliches Verhältnis zu den Tierlauten ist. Nicht nur lassen sich die Tonsysteme nicht miteinander vergleichen, die Ausdruckswelten sind völlig divers. Dieses Befremden schlug sich durch all die Jahrhunderte in zeichnerischen Karikaturen von musizierenden Eseln, Hunden, Gänsen und vor allem Affen nieder, aber auch in musikalischen Nachahmungen. Dabei kam es durchaus vor, dass da ein Künstler die Naturmusik dem Menschenlärm vorzog. Und manche Anekdote führt einmal mehr, wenig überraschend eigentlich, vor Augen, wie grausam das edle Menschengeschlecht mit den Tieren umging. Athanasius Kircher etwa berichtet von einer Katzenorgel: Den darin eingeschlossenen Tieren wurden dabei via Tastatur Nadeln in die Schwänze gestochen!
Das Quellenmaterial, das Gredig hier präsentiert, ist höchst disparat und reichlich. Der junge Musikwissenschaftler, der 2017 über das Thema in Basel dissertierte, legt nun ein überwältigendes Kompendium über «Tiermusik» vor. Es führt weite Wege, vom ältesten Altertum bis ins 19. Jahrhundert, von Pythagoras bis Thoreau und Alkan, von ptolemäischen Skulpturen bis zu Grandville, und schliesslich bis in unsere Tage, es ist manchmal auch weitschweifig, aber stets lehrreich, lädt zum Sich-Verlieren ein, zieht nebenher auch einige Gewissheiten in leisen Zweifel – und ist insgesamt doch leicht, ja amüsant zu lesen.
Mathias Gredig: Tiermusik. Zur Geschichte der skeptischen Zoomusikologie; 506 S., € 64.00, Königshausen & Neumann, Würzburg 2018, ISBN 978-3-8260-6468-5