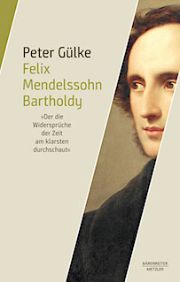Mendelssohn bleibt ein heisses Eisen
Peter Gülke zeichnet ein Bild von Felix Mendelssohn Bartholdy, das von den Paradoxien jener Zeit und einer immer noch einseitigen Betrachtung der Werke bestimmt ist.

Wenn das Streichquartett op. 80 in f-Moll als erstes Werk genauer betrachtet wird und zur Frage führt, «Warum überwiegt im instrumentalen Bereich (…) das Moll-Geschlecht so auffällig», so bewegt sich der Autor im Bereich seiner früheren Publikation von 2015, Musik und Abschied. Dort hatte er in einer Reihe von Werken vom Mittelalter bis zur Gegenwart unter dem gemeinsamen Aspekt des Todes verblüffende Einsichten vereinigt. Mendelssohns Opus 80 irritiert uns in seiner Rücksichtslosigkeit gegenüber der Form; es ist kurz nach dem Tod seiner Schwester Fanny entstanden – und einige Monate später ist auch er tot. Gülke will mit diesem Aufbau gleich zu Beginn dem Verdikt von «Perfektionismus» und «Glätte» entgegentreten, das auch heute noch bei Werkbeschreibungen gegen Mendelssohn ins Feld geführt wird. Und er beendet diesen Abschnitt mit dem Satz: «Auch dieser frühe Tod gehört zu den Katastrophen der Musikgeschichte.»
Gülke weicht den Fragen nicht aus, er provoziert sie sogar unverzüglich, wenn er nicht beim Oktett und bei der Musik zum Sommernachtstraum weiterfährt, den heute populären und anerkannten Werken, sondern anhand der Klaviersonate op. 6 und des Streichquartetts op. 13 des noch nicht Zwanzigjährigen auf schon eigenständige Bezüge zu grossen Vorbildern hinweist. Sein Talent, den Musikverlauf analysierend und doch anschaulich zu beschreiben, bewährt sich auch dort, wo er sich «nur» auf (für ihn) auffällige Details beschränkt, die aber immer erhellend zu einer individuellen Einsicht führen.
Mit dem kryptischen Schumann-Zitat als Untertitel, das er gleich auf der ersten Seite noch vervollständigt, «Er ist der Mozart des 19. Jahrhunderts, der hellste Musiker, der die Widersprüche der Zeit am klarsten durchschaut und zuerst versöhnt», stellt Gülke die Bedeutung des Komponisten für den Zeitraum der ‚Romantik‘ ins Zentrum. Gleichzeitig verweist er auf die Schwierigkeiten bei der Beurteilung des Gesamtwerks und der Biografie: «Mendelssohn bleibt ein heisses Eisen.»
Die privilegierte familiäre Situation, die sensationelle Frühbegabung der Geschwister Fanny und Felix, die einseitige Förderung des Knaben und die damit verbundene Blockade der Kreativität seiner Schwester kommen ungeschönt zur Darstellung, ebenso die zahlreichen geistlichen Werke von Felix, welche die Ernsthaftigkeit der Konversion zum Christentum belegen sollten, dann aber mit den beiden Oratorien Paulus und Elias doch zeigten, dass er keine der Religionen bevorzugen wollte – von seiner Reformations-Sinfonie hat er sich ja distanziert und sie nicht zum Druck freigegeben.
Das umfangreichste Kapitel, «Im schönen Zugleich von Kunst und Religion», konzentriert sich auf diesen Bereich der geistlichen Musik, wo Gülke die Widersprüche am deutlichsten festmachen will: «Viele Kompositionen, komplementär zur Reformations-Sinfonie und zum Lobgesang, muten wie Versuche an, die Unterscheidung geistlich/weltlich von der weltlichen Seite her zu unterlaufen.» Und an anderer Stelle: «Nirgendwo bei Mendelssohn widersprechen Rezeption und Wertungen einander so schroff wie bei geistlicher Musik.» Die ausführlichsten Werkbetrachtungen widmet Gülke deshalb den beiden Oratorien, gibt aber zu bedenken: «Beim Versuch, in Mendelssohns Musik möglichst tief hineinzuhören, riskieren wir, ihn anders zu verstehen, als er verstanden sein wollte.»
Peter Gülke: Felix Mendelssohn Bartholdy, «Der die Widersprüche der Zeit am klarsten durchschaut», 139 S., mit Illustrationen und Literaturverzeichnis, € 29.99, Bärenreiter/Metzler, Kassel/Stuttgart 2017,
ISBN 978-3-7618-2462-7