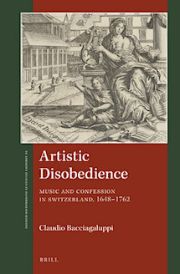Konfessionell fremdsingen
Claudio Bacciagaluppi hat untersucht, wie sich die Musik in katholischen und reformierten Ständen der Alten Eidgenossenschaft unterschied und wie fern von obrigkeitlichen Standpunkten ein Austausch stattfand.
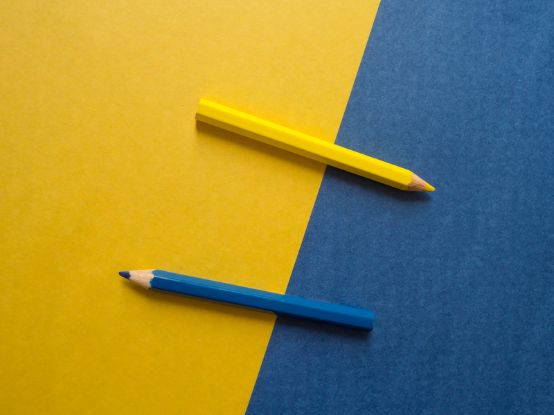
Wie wohl der geistige Austausch in der Alten Eidgenossenschaft funktionierte, die seit der Reformation in zwei konfessionelle Lager zerfiel? Da wurde ja gestritten und auch mal ein Gefecht ausgetragen – was dann jeweils wieder mit einem «Landfrieden» beruhigt wurde. Wie «segregiererisch» verhielten sich die Kantone aber kulturell zueinander? Wie ab- oder aufgeschlossen waren sie musikalisch?
Der Musikwissenschaftler Claudio Bacciagaluppi, aus der Lombardei stammend, in Zürich und Fribourg ausgebildet, sitzt als Mitarbeiter des Schweizer RISM (Répertoire International des Sources Musicales) an der Quelle bzw. den Quellen, so dass er diese Fragen eingehend erforschen konnte. Wie verhalten sich Musik und Konfession in der Schweiz zwischen dem Ende des 30-jährigen Kriegs 1648 und der Gründung der überkonfessionellen und aufklärerischen Helvetischen Gesellschaft 1762 in Schinznach-Bad.
Anzunehmen ist ja, dass sich die Musiken allein der Liturgien wegen deutlich unterschieden. Was aber, wenn ein Zürcher Gefallen am neuartigen italienischen Drive und seiner eingängigen Melodik fand? Offiziell, d. h. auf der Ebene der Repräsentationen, waren die konfessionellen Welten getrennt. Darunter jedoch, zum Beispiel in den aufblühenden städtischen Musikgesellschaften und Collegia Musica, fand ein reger Austausch statt. Die von oben verordnete «rigid morality» wurde im privaten Bereich durch «oases of comparative relaxation» ausgeglichen. Man sang also fremd – über die Konfessionsgrenzen hinweg.
Da gleich von «Artistic Disobedience», von künstlerischem Ungehorsam, zu sprechen, mag etwas übertrieben wirken – so, als habe man in den Collegia musikalischer Subversion gefrönt. Und doch, betont Bacciagaluppi, ist solche Unorthodoxie nicht als eine «quantité négligeable» zu betrachten. Im Untergrund hat die Musik zu einer pragmatischen Verständigung zwischen den Konfessionen und zur religiösen Toleranz beigetragen, wie sie sich dann in Johann Caspar Lavaters Loblied auf Helvetische Eintracht von 1767 formulierte: «Wer Gott liebt und redlich ist, / Mag, wie er nur will, sich nennen; / Bruder ist er, und ein Christ!»
All diese Entwicklungen und Verstrebungen legt der Autor auf umsichtige und kluge Weise dar – englisch leider (bei einem so eminent deutschschweizerischen Thema), aber doch leicht verständlich geschrieben. Illustrationen und eine Sammlung zeitgenössischer (deutschsprachiger) Dokumente ergänzen die Darlegung, so dass man auch sinnlich (wenn auch ohne die Musik) in jene Epoche eintauchen kann.
Claudio Bacciagaluppi: Artistic Disobedience. Music and Confession in Switzerland 1648–1762, St Andrews Studies in Reformation History, 263 S., ill., € 105.00, Brill, Leiden 2017, ISBN 978-90-04-33075-7