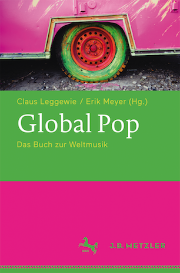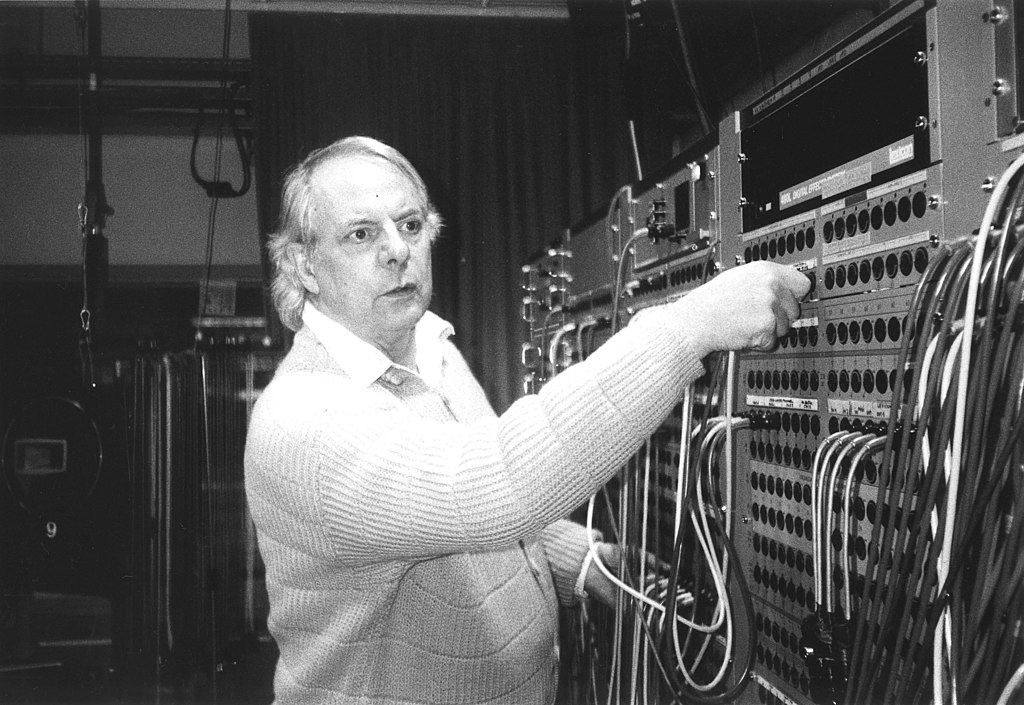Mut zur Lücke
Zusammen mit Kulturwissenschaftler Erik Meyer hat Politikwissenschaftler Claus Leggewie den Band «Global Pop – Das Buch zur Weltmusik» veröffentlicht.

Ende der 1970er-Jahre lebte Leggewie in Algerien, wo er mitverfolgte, wie der Raï, die Volks- und Populärmusik des Maghreb-Staates, zusehends aufblühte. Sowohl der Raï als auch so unterschiedliche Gattungen wie Afro-Beat oder Balkan-Pop werden seit Jahrzehnten unter dem Begriff «Weltmusik» subsumiert. Aus der Sicht der beiden Herausgeber ein überkommener Begriff, «ein koloniales Relikt». Sie bevorzugen die Bezeichnung Global Pop. Laut Leggewie und Meyer steht er «für eine Sammelkategorie aller erdenklicher Stilrichtungen und Regionalursprünge nicht-westlicher, speziell nicht-westlicher Musik».
In einem Interview mit dem WDR sagte Leggewie, das Buch beweise «Mut zur Lücke». In der Tat: Das knapp 400 Seiten starke Werk versteht sich nicht etwa als Lexikon, sondern als Lesequelle mit über vierzig Beiträgen verschiedener Autoren – unter ihnen auch Johannes Rühl, künstlerischer Leiter des internationalen Musikfestivals Alpentöne in Altdorf. Während sich der erste Teil des Bandes darum bemüht, Begriffe wie Folklore, Transkulturalität oder eben Weltmusik zu erläutern, bietet der Folgeabschnitt sauber recherchierte, jedoch nicht abschliessende Porträts einflussreicher Akteure wie des Musikethnologen Brian Shimkovitz, der auf seinem Blog hunderte afrikanischer Musiktapes zugänglich macht, oder des US-amerikanischen Gitarristen Ry Cooder. Dieser hat sich in den vergangenen Jahrzehnten voller Neugier mit wechselnden Stilrichtungen wie Tex-Mex, Mali-Blues oder kubanischem Son auseinandergesetzt und 1996 mit dem Album Buena Vista Social Club die Wiederentdeckung vergessener kubanischer Musiker wie Ibrahim Ferrer ausgelöst.
Kapitel drei thematisiert dann die Marktbegebenheiten hinter der Musik. So beschreibt Klaus Näumann, Professor am Institut für Europäische Musikethnologie der Universität Köln, in seinem Text «Weltmusikfestivals und Festivalisierung der Weltmusik», wie World-Music-Events die Illusion globaler Harmonie und gegenseitiger Akzeptanz suggerierten. In Tat und Wahrheit werde von einer weissen, tendenziell links orientierten Mittelschicht dabei jedoch nur das zelebriert (Musik, Kleidung, etc.), was dem Ideal nicht zuwiderlaufe. Im grössten und abschliessenden Teil präsentiert Global Pop kurze Abrisse zu zahlreichen Genres wie Rembetiko, Highlife oder J-Pop. Diese sind nicht für die Spezialisten der jeweiligen Stilrichtungen gedacht, sondern für Uneingeweihte und Interessierte. Das Buch arbeitet exemplarisch, sprich: Die Schwerpunkte liegen ganz im Ermessen der beiden Herausgeber. Dementsprechend liesse sich nur zu leicht monieren, dass etwa weder der Tango noch Gamelan – die Musikensembles Indonesiens – Eingang ins Buch gefunden haben. Doch das bleibt letztlich Nebensache, denn: Mit Global Pop mag Leggewie und Meyer zwar nicht das definitive Buch zum Thema gelungen sein, dafür eins, das neugierig macht und nicht nur zum vertiefenden Weiterlesen, sondern auch zum Anhören der erwähnten Künstler anregt.
Global Pop – Das Buch zur Weltmusik, hg. von Claus Leggewie und Erik Meyer, 392 S., Fr. 31.00, J. B. Metzler, Stuttgart 2017, ISBN 978-3-476-02636-1