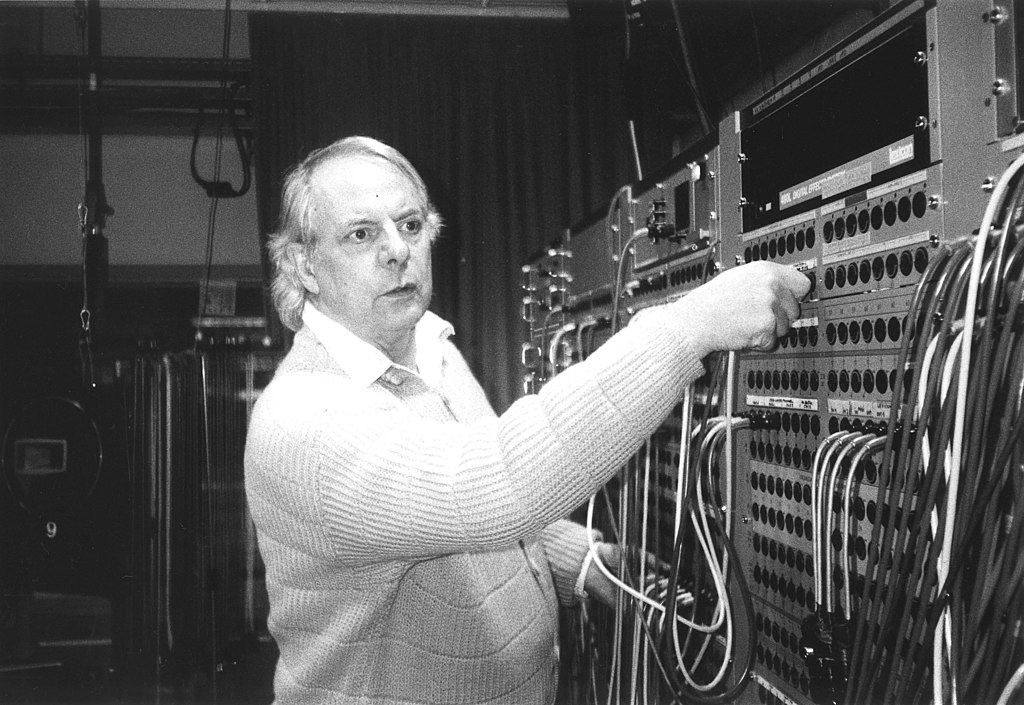Sozialgeschichte des Tastenspiels
Der Beruf des Organisten, Cembalisten, Clavichordspielern oder Pianisten von 1400 bis 1800.

Über das Berufsbild des Kirchenmusikers oder der Organistin nachzudenken, ist nicht nur in unserer Zeit eine lohnenswerte Aufgabe. Siegbert Rampe, hoch produktiver Musikwissenschaftler, Herausgeber und Musiker, befasst sich in diesem interessanten Buch mit dem soziologischen Hintergrund zu rund 400 Jahren Musikschaffen für Tasteninstrumente. Auf der einen Seite untersucht er die Situation der Berufsmusiker hinsichtlich ihres Einkommens (auch Nebeneinkünfte, beispielsweise durch das gezielte Zurverfügungstellen von Partituren als Kopiervorlage für andere Musiker), aber auch im Bezug auf ihre Dienstpflichten in Kirche, am Hof und im Gemeinwesen, auf ihre Ausbildung, auf die ihnen zur Verfügung stehenden Instrumente und ihren Zugang zu Musikalien. Dabei vertritt er die These, dass «Claviermusik» (wo natürlich, gemäss dem damaligen Sprachgebrauch, auch die Orgelmusik eingeschlossen ist) in dieser Zeit primär didaktischen Zwecken in der Ausbildung angehender Musiker diene – also gewissermassen als «Modell» für Improvisation und Komposition oder aber für das private Musizieren von Amateuren entstehe, die weder improvisatorisch noch kompositorisch in der Lage seien, Vergleichbares zu schaffen. Diesen «Amateurmusikern» ist dann der zweite Teil des Buchs gewidmet. Ein Epilog betrachtet die für den deutschsprachigen Raum gewonnenen Erkenntnisse im internationalen Kontext und verweist auf Ähnlichkeiten und Unterschiede, zum Beispiel in konfessioneller Hinsicht, beim national vorherrschenden Instrumentarium (in Frankreich und Italien klare Dominanz des Cembalos, in Deutschland des Clavichords) oder bei der Tatsache, dass der Prozentsatz clavierspielender «Liebhaber» direkte Konsequenzen auf die Publikation von gedruckten Ausgaben hat.
Rampe belegt seine Theorien mit einer Fülle von Zitaten und Quellenangaben (das Literaturverzeichnis umfasst 26 Seiten an Primär- und Sekundärquellen sowie Notenausgaben). Fazit: eine lohnenswerte Lektüre mit einer Fülle an Informationen, die sicher, so auch die Absicht des Autors, zu einem besseren Verständnis der Musik jener Zeit sowie zu einer Annäherung an die Lebens- und Arbeitsumstände ihrer Schöpfer beiträgt.
Siegbert Rampe: Orgel- und Clavierspielen 1400–1800, Eine deutsche Sozialgeschichte im europäischen Kontext, (Musikwissenschaftliche Schriften 48), 353 S., € 39.80, Musikverlag Katzbichler, München/Salzburg 2014, ISBN 978-3-87397-148-6