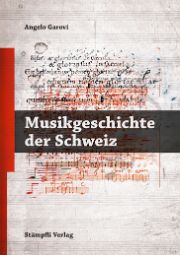Musikgeschichte der Schweiz
Mit der umfassenden Neuerscheinung von Angelo Garovi – Historiker, Musikologe und Organist – wurde eine Lücke geschlossen.

Angelo Garovi – Organist, Historiker, Musikologe, langjähriger Radioredaktor, Staatsarchivar und Universitätsprofessor – bedauerte jahrelang das Fehlen einer neueren Musikgeschichte der Schweiz, bis er sich selber ans Schreiben machte. Vorerst plante er einen Sammelband ähnlich dem Schweizer Musikbuch, das Willi Schuh 1939 zusammen mit zwölf Mitarbeitern herausgegeben hatte. Je mehr der Autor sich aber mit dem Thema in seiner ganzen Breite von der spätrömischen Wasserorgel in Avenches bis zu Mathias Spohrs eben erschienener Anthologie Schweizer Filmmusik beschäftigte, desto klarer wurde die Absicht, das Manuskript nach dem Vorbild von Antoine-Elisée Cherbuliez‘ Standardwerk Die Schweiz in der deutschen Musikgeschichte (1932) als Einzelpublikation zu verfassen. Die Einladung der nordostdeutschen Universität Greifswald zu zwei Gastsemestern erlaubte es Garovi, sein Konzept zu einer Musikgeschichte der Schweiz zu erproben und den Vorlesungstext anschliessend für das vom Verlag verlangte Taschenbuch zu verdichten.
Vor kurzem konnte ein 160-seitiges Büchlein erscheinen, das in 30 knappen Kapiteln über den verblüffend vielseitigen Musikbeitrag der Schweiz informiert. Ein Anhang listet rund dreihundert Namen von Musikschaffenden auf – unter ihnen bisher kaum bekannte komponierende Klosterfrauen und ausländische Komponisten, die sich durch Motive aus der schweizerischen Volksmusik oder Aufenthalte in der Schweiz zu Tonwerken haben anregen lassen. In diesem Zusammenhang dürfte ergänzt werden, dass Bohuslav Martinů seine drei letzten Lebensjahre in der Schweiz verbracht und in Liestal die Oper Die griechische Passion geschrieben hat.
Die Selektion der weiterführenden Literatur zeugt von der Belesenheit und Originalität des Autors. So werden die zu Unrecht in Vergessenheit geratenen Einzelpublikationen und Aufsätze von Arnold Geering ins rechte Licht gerückt, während man Max Peter Baumanns massgebende Dissertation Musikfolklore und Musikfolklorismus, die erste wissenschaftliche Auseinandersetzung mit der Jodelkultur, vermisst. Diese Makel, zu denen auch kleine, ganz vereinzelte Ungenauigkeiten zählen – der St. Galler Komponist und Erneuerer der Alphorntradition Ferdinand Fürchtegott Huber wird zum Beispiel als Johann Fürchtegott angeführt – lassen sich in einer weiteren Auflage dieses leicht lesbaren und nützlichen Buches beheben und schmälern weder Dankbarkeit noch Anerkennung für eine Publikation, die ihresgleichen sucht.
Man kann ihr entnehmen, dass im Kloster St. Gallen des 10. Jahrhunderts mit Sequenz (einstimmige Vertonung des Alleluia-Verses) und Tropus (syllabische Textgestaltung melismatischer Gesänge) neue Formen der vokalen Kirchenmusik gepflegt und gefördert wurden. Die Wichtigkeit des Konzils von Basel für die mehrstimmige A-cappella-Musik wird dem aufmerksamen Leser bewusst, führte man damals, im 15. Jahrhundert, doch Werke von Dunstable, Dufay und anderen noch lebenden Komponisten auf.
Der Autor, ein quellenkundiger Historiker, kann aus Luzerner Rechnungsbüchern des 14. und 15. Jahrhunderts die Musik alltäglicher Bürger auffächern, während sich die Militärmusik jener Zeit in den Bilderchroniken der alten Eidgenossen spiegelt. Ebenfalls der Hinweis auf den Franzosen Antoine Brumel, Musiker aus Ferrara und von 1486-1490 Organist in Genf, überrascht. Erstmals lässt sich zudem die Erfolgsgeschichte des von verschiedenen Kirchenmusikern vertonten und 1573 auf Deutsch übersetzten Genfer Psalters erahnen, diente dieses erste Gesangbuch der Reformierten doch bis ins 19. Jahrhundert als verbreitetes Hausbuch, das heute noch bei konservativen Old Order Amish in im mittleren westen Nordamerikas verwendet wird.
Unter den Barockkomponisten verdienen Nicolaus Scherrer, der von Händel bewunderte Genfer Geiger Gaspard Fritz und der Luzerner Chorherr Franz Joseph Leonti Meyer von Schauensee, dessen Werke Leopold Mozart in Salzburg aufführte, mehr Beachtung. Als schweizerische Musikgattung des 19. und 20. Jahrhunderts wird das Festspiel bis hin zu Arthur Honegger, Frank Martin und die von Mal zu Mal neu geschaffenen Kompositionen der Fête des vignerons in Vevey erwähnt.
Garovi, der Sohn eines der Zwölftonmusik verpflichteten Komponisten, war von Haus aus vertraut mit der zeitgenössischen Musik und vertiefte seine Kenntnis auch als Radioredaktor dieser Sparte. So gelten denn die Kapitel zur Musik des 20. und 21. Jahrhunderts – sie machen ein Viertel der Publikation aus – als besonders informativ und dokumentieren, dass die Schweiz mit weltberühmten Komponisten wie Klaus Huber, Heinz Holliger, aber auch mit Jürg Wyttenbach, Roland Moser, Hans Ulrich Lehmann, Alfred Schweizer, Balz Trümpy , Beat Furrer u. a. m. einen wichtigen Beitrag zur Musik unserer Zeit leistet.
Angelo Garovis Musikgeschichte der Schweiz verdient grosse Verbreitung und würde sich, auf Englisch übersetzt, als Pflichtlektüre für die zahlreichen ausländischen Musikstudierenden an schweizerischen Musikhochschulen eignen.
Angelo Garovi, Musikgeschichte der Schweiz, 160 S., Fr. 19.90, Stämpfli, Bern 2015, ISBN 978-3-7272-1448-6