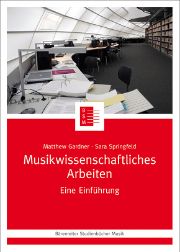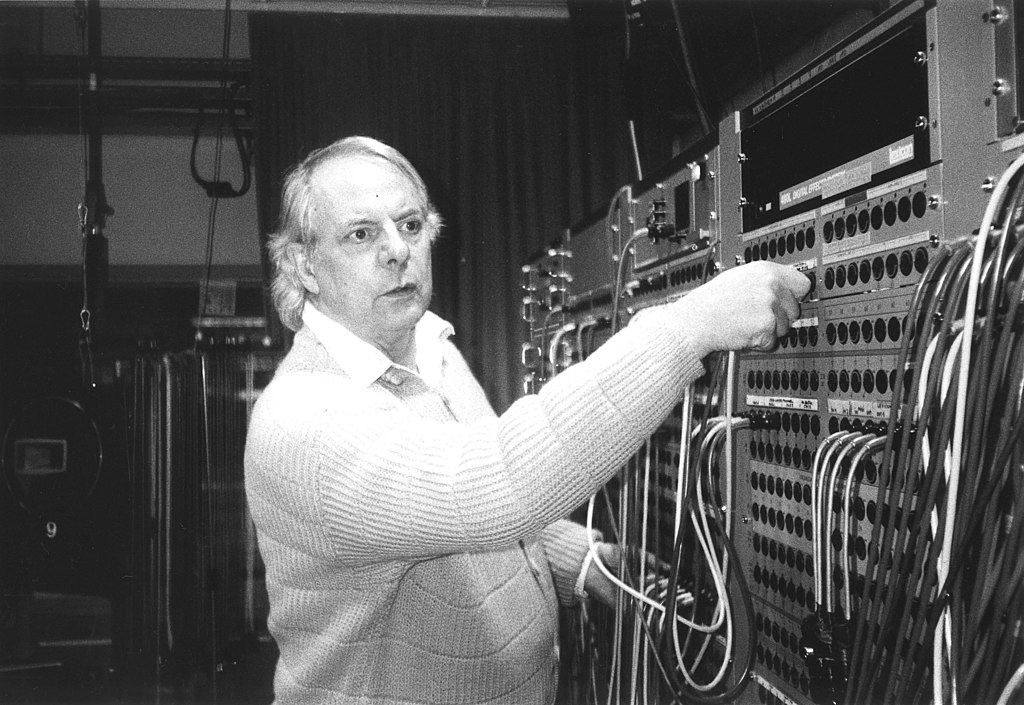Ein zeitgerechter Begleiter
Auch das Studium der Musikwissenschaft sieht im digitalen Zeitalter ganz anders aus als früher. Nun gibt es den passenden Studienführer.

Als ich das Studium der Musikwissenschaft antrat, Anfang der Neunzigerjahre, stand uns Studierenden der DTV-Atlas der Musik sowie die Einführungen der Wissenschaftlichen Buchgesellschaft Darmstadt zur Verfügung. (Ich kann mich noch gut an Feders Musikphilologie und Reidemeisters Historische Aufführungspraxis erinnern.) Ein umfassendes Vademecum zum Einstieg ins Fach kannten wir (noch) nicht. Gerade 1992 veröffentlichte aber Nicole Schwindt-Gross für Bärenreiter eine solche Einführung mit dem Titel Musikwissenschaftliches Arbeiten, die sich über verschiedene Neuauflagen mit mehr als 20 000 verkauften Exemplaren zu einem Bestseller entwickelte. Seitdem sind weitere Bücher mit der Zielsetzung erschienen, einen praktischen Studienbegleiter und ein Nachschlagewerk für angehende Musikwissenschaftler bereitzustellen, beispielsweise der von Kordula Knaus und Andrea Zeder herausgegebene Sammelband Musikwissenschaft studieren (Herbert Utz Verlag, München 2012). Nun legt Bärenreiter einen Nachfolger des Buches von Schwindt-Gross vor.
Erst gegen Ende meiner Studienzeit hörte ich etwas skeptisch von meinem älteren Bruder, dass er fast täglich von einem Nachrichtenprogramm namens «Email» Gebrauch mache. Es sind denn auch primär die tiefgreifenden Veränderungen, die das Internet seit 1992 für die Recherche und das Studium gebracht hat, die ein Nachfolgewerk notwendig machen. So finden sich im Inhaltsverzeichnis in fast jedem Kapitel Abschnitte, die dem Digitalzeitalter gerecht werden: «Wikipedia – geeignet für den ersten Überblick?», «Das Internet als Informationsmedium», «Grundlagen der Onlinerecherche». Die Grenzen und die Vorteile von Wikipedia, Google Books & Co. werden nüchtern, ohne Vorurteile dargestellt. Die aufgeführten Beispiele aus der digitalen Welt sind der aktuellen Forschung entnommen wie z. B. die Software Edirom (www.edirom.de) und das Projekt Opera (www.opera.adwmainz.de) im Kapitel «Digitale und digitalisierte Notenausgaben».
Neben der umfassenden und zeitgemässen Darstellung der digitalen Möglichkeiten wissenschaftlichen Arbeitens, sind auch andere Kapitel erwähnenswert, die von einer altmodischen Fixierung auf die Schriftlichkeit absehen: Abschnitte über Tonträger und audiovisuelle Medien, Bilder, Musikinstrumente, ja Gebäude und Räume als Objekt musikwissenschaftlicher Betrachtung. Willkommen ist auch das Kapitel zum mündlichen Referieren und Vortragen. Etwas zu kurz kommt allerdings die Erörterung der beruflichen Perspektiven eines Studiums der Musikwissenschaft; es wird dafür auf einschlägige Literatur verwiesen.
Der Inhalt wird übersichtlich präsentiert. Kästchen mit grauem Hintergrund heben Tipps und Zusammenfassungen vom Fliesstext ab. Nach jedem Abschnitt folgen hilfreiche Fragen zur Selbstüberprüfung und kurze bibliografische Hinweise. Eine ausführliche Literaturliste und ein Register finden sich dann am Schluss des Buches. Die beiden Autoren Matthew Gardner und Sara Springfeld werden also ihrem Anspruch gerecht, den Studierenden ein praktisches Lehr- und Nachschlagebuch in die Hände zu legen. Für Dozierende wird das Buch aber auch von Nutzen sein: Es hilft nämlich, sich die Ausgangslage der jungen Leute zu vergegenwärtigen, die bereits in der Wiege auf dem www zu surfen gelernt haben.
Matthew Gardner und Sara Springfeld, Musikwissenschaftliches Arbeiten. Eine Einführung,292 S., € 24.95, Bärenreiter, Kassel 2014, ISBN 978-3-7618-2249-4