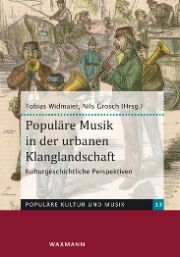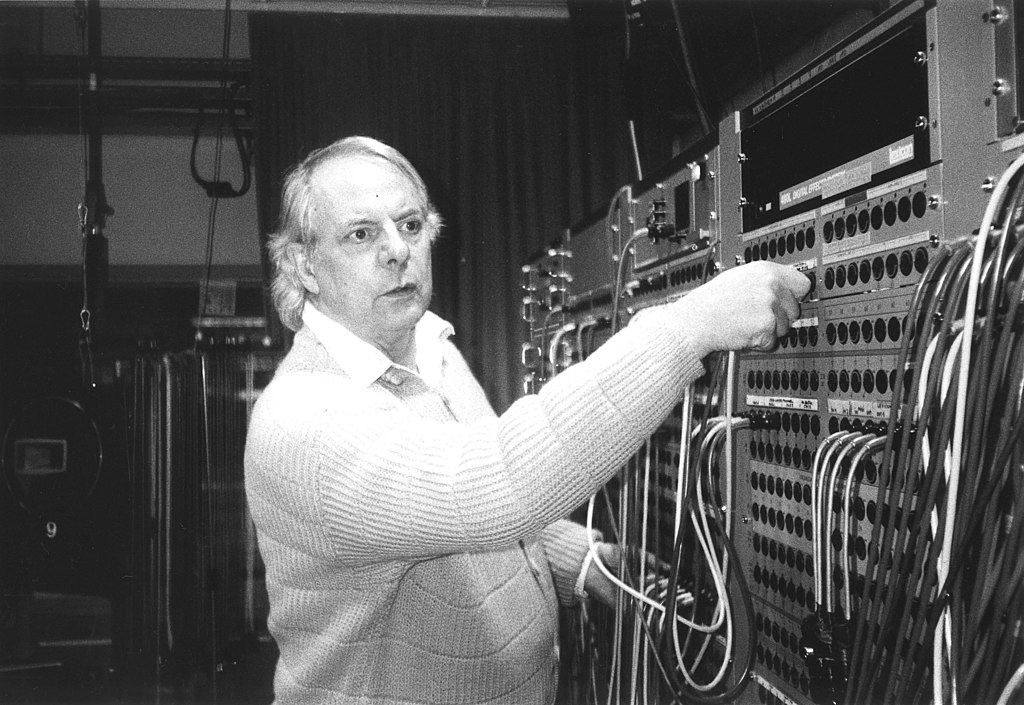Das Getöse in den Städten
Auch in vergangenen Zeiten fühlte man sich durch Lärm belästigt, durch Musik im öffentlichen Raum. Diese Aufsätze beleuchten bisher wenig beachtete Seiten der musikalischen Kultur.

Wer den Titel Populäre Musik in der urbanen Klanglandschaft liest, der wird vermutlich an Open Air Festivals denken oder an Bob Dylan-Interpreten in der Fussgängerzone. Nicht weit gefehlt. Aber in diesem faszinierenden Sammelband mit zehn Aufsätzen geht es nicht ums nähere Heute, dafür ums Gestern, quasi um den Pop vergangener Zeiten. Die Londoner Vauxhall Gardens des mittleren 18. Jahrhundert kommen zur Sprache, Hamburger Blasmusiker im 19. Jahrhundert oder auch die riesigen Beschallungsanlagen aus der Frühzeit des vergangenen Jahrhunderts.
Nun, was war denn Pop um 1800? Den Musikwissenschaftler Martin Thrun beschäftigten die öffentlichen Konzerte in den Londoner Vauxhalls – jenen Vergnügungsparks, wo Feuerwerke stattfanden, wo Gemälde hingen, Statuen standen, wo man ass oder sass. 1764 lobte Leopold Mozart noch die «schöne Music» der Vauxhall Konzerte; Joseph Haydn notierte um 1794, die Musik in den Londoner Parks sei «ziemlich gut». Eindrücklich ist Thruns Befund, dass es just mit Beethoven als dem Repräsentanten absoluter Musik zu einem Repertoire-Wandel kam. Während Joseph Haydn und Georg Friedrich Händel bis 1803 noch oft auf dem Programm standen, ging es nun mehr in Richtung marschier- und tanzbar, hin zum Walzer, zu Quadrillen, zur Blasmusik der Militärkapellen. Das Resultat: 1815 berichtete die deutsche Fachpresse von «sehr mittelmässigen Conzerten», 1834 beurteilten deutsche Kritiker die «Marsch- und Tanzmusik» als «leichtes, gehaltloses Zeug».
Es gibt viele weitere interessante Befunde, wenn sich Musikwissenschaftler und Kulturhistoriker einmal distanzieren vom elitären Kanon der Hochkultur. Heute ist von «akustischer Umweltverschmutzung» die Rede. Aber es gab sie auch schon im 19. Jahrhundert, als deutsche Strassenmusikkapellen zwar in London und sogar New York reüssierten, zugleich aber ihrer Lautstärke wegen auf weniger Gegenliebe stiessen. Politische Dimensionen öffentlicher Beschallung bringt die Musikwissenschaftlerin Sonja Neumann zur Sprache in ihrem Artikel «Die Anfänge der elektroakustischen Beschallung im urbanen Raum». Sogenannte Pilzlautsprecher der Firma Telefunken kamen zum Einsatz bei der Gedenkfeier zum Hitler Putsch am 9. November 1935 auf dem Münchener Königsplatz; elektrisch verstärkt wurde auch das Musikprogramm des Festzugs am Tag der Deutschen Kunst im Jahr 1937, das aus Fragmenten der Musik Richard Wagners, Georg Friedrich Händels und Anton Bruckners bestand. Dass das Getöse aus elektrischer Verstärkung, 86 Fanfarenbläsern und 38 Kesselpauken aus künstlerischer Sicht bestimmt fragwürdig war, ändert nichts an der Tatsache, dass die Betrachtung der Musik im Öffentlichen Raum mindestens so wichtig ist wie die der Konzerthaus-Musik. Die Musikwissenschaft hat hier vieles vernachlässigt – aber dafür nun einiges aufzuarbeiten.
Populäre Musik in der urbanen Klanglandschaft. Kulturgeschichtliche Perspektiven, hg. von Tobias Widmaier und Nils Grosch, 216 S., € 34.90, Waxmann, Münster 2014, ISBN 978-3-8309-2261-2