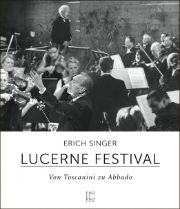Vom lokal Engen zum Kosmopolitischen
Eine Festspielgeschichte beleuchtet die Entwicklung der Musikfestwochen von 1938 bis zum heutigen Lucerne Festival mit wechselnden Schwerpunkten.

Er ist zweifellos einer der profundesten Kenner des Lucerne Festivals: Erich Singer, der ab 1980 für die Festwochen tätig war als Leiter des künstlerischen Büros und Redaktor der Programmhefte. Ein positiver wie negativer Umstand, denn wer einer Institution so nahe ist, hat es schwer, kritischen Abstand zu wahren.
Lange hat man auf das Resultat von Singers Recherchen gewartet, nun ist es endlich da unter dem Titel Lucerne Festival – Von Toscanini zu Abbado: ein umfangreicher, höchst bibliophiler «Wälzer» von 400 Seiten mit zahllosen, bisher unbekannten Abbildungen, bei denen man stundenlang verweilen kann – einer der grossen Vorteile dieser Festspielgeschichte.
Nach der Lektüre des detailreichen Textes muss man sich allerdings fragen, wo ein deutender Autor am Werk ist und wo dieser Anspruch endet. Bis zum Ende der Ära Ulrich Meyer-Schoellkopf wählt Singer als Gliederungsprinzip mehr oder weniger die einzelnen Saisons, stellt Programme zur Diskussion oder fokussiert auf Debüts wichtiger Dirigenten oder Solistinnen und Solisten. Bei der Ära Matthias Bamert ändert die Gestaltungsweise, nun setzt Singer thematische Schwerpunkte, «Festival im Festival», «Composer in Residence» oder «Late-Night-Konzerte» heissen die Überschriften. Es sind Neuerungen, die Bamert in seiner Amtszeit in Luzern eingeführt hat.
Dann folgen das «Sonderjahr 1997», der Abriss des Kunsthauses und das Gastspiel in Emmen. Hier lässt Singer plötzlich von ihm interviewte Persönlichkeiten wie Bamert und Toni Krein, damals Leiter des künstlerischen Büros, erzählen. Ein Prinzip, das der Autor auch für die folgende «Gegenwart» ab 1998 anwendet, wo er auf lediglich 23 Seiten mehrheitlich Intendant Michael Häfliger, Präsident Hubert Achermann und andere Auskunft geben lässt.
Als «accelerierendes Verfahren» bezeichnet Singer dieses Vorgehen, mit dem er elegant Friktionen mit der aktuellen Intendanz umgehen kann und obendrein verhindert, dass die Festspielgeschichte zu sehr ausufert. Denn was die Anfänge betrifft, sind diese extensiv recherchiert und differenziert bewertet. Zwar gibt es zur Mär vom antifaschistischen «Gegenfestival» von 1938 mit Toscanini nichts Neues, aber Singer schreibt treffend: «Die politischen Ereignisse fungierten gewissermassen Schritt für Schritt als Voraussetzung für den Handlungsspielraum der Luzerner Organisatoren.»
Anregend ist es allemal, wie der Autor die Geschichte entwickelt: die Euphorie um Toscanini, der Geldsegen durch den umstrittenen Emil Bührle ab 1942, der damit mögliche Aufbau des Festspielorchesters, die triumphalen Jahre mit den charismatischen Dirigentenpersönlichkeiten Wilhelm Furtwängler und Herbert von Karajan, der Einzug so namhafter Künstler wie Dinu Lipatti, Yehudi Menuhin oder Clara Haskil – um nur einige zu nennen.
Spannend wird es immer dann, wenn Singer wertend eingreift, etwa beim Fazit zu Walter Strebis Präsidentschaft, denn dieser «beliess … die zahlungsfähige Besucherschaft im kulturbürgerlichen Glauben, dass Schönes vor allem schön und festlich serviert werden müsste». Oder wenn er 1966 als ein Jahr der Ablösung bezeichnet: «André Cluytens starb ein knappes Jahr nach seinem letzten Luzerner Konzert …, Bernhard Haitink und Claudio Abbado hingegen betraten zum ersten Mal das Kunsthaus-Podium.» Auch die Krise von 1968 wird aufgearbeitet und die Presse gerügt: «Kurz, jede Un- und Halbwahrheit wurde ausgeschlachtet.» Damals schlug für Luzern die Stunde der Professionalisierung, die Einführung des im Ausland «längst praktizierten und bewährten Direktorialprinzips». Mit Rudolf Baumgartner gab es erstmals einen künstlerischen Direktor, der das Gesamtprogramm unter ein Leitthema stellte.
Singer schildert eindrücklich Baumgartners Innovation, die Berücksichtigung der Moderne, sein Bemühen um neue Publikumsschichten und sein Scheitern: «Somit schoss Baumgartner unter den Voraussetzungen und Bedingungen seiner Zeit übers Ziel hinaus. Die künstlerische Vision allein genügte nicht: der Unterboden (Publikum, Ökonomie, Lokalpolitik usw.) vermochte die allzu befrachtete Saat kompromissloser Kreativität (noch) nicht zu schlucken.»
Während hier analysiert wird, bleibt die Darstellung umso deskriptiver, je näher man der Gegenwart kommt. Die Hintergründe der Auflösung des Festspielorchesters bleiben im Dunkeln, es gibt kein kritisches Wort zur Entwicklung des Festivals in den letzten Jahren. «Als ehemaliger Hotelier mit internationaler Klientel verlegte er [Jürg R. Reinshagen, Stiftungsratspräsident bis 2009] die Gewichte vom lokal Engen, gar Provinziellen zum Kosmopolitischen», schreibt Singer, dessen Fokus auf dem gewaltigen Ausbau liegt. Das KKL hat viel dazu beigetragen.
Erich Singer: Lucerne Festival – Von Toscanini zu Abbado, 400 S., inkl. DVD, Fr. 79.00, Pro Libro, Luzern 2014,
ISBN 978-3-905927-03-0