SMM — Die Kulturwissenschaftlerin Hannah Bregler erinnert daran, dass sich in berufsmusikalischen Karrieren zahlreiche physiologische, soziale und psychische Anforderungen stellen. Im Rahmen einer Arbeit für das Hamburger Institut für Kultur- und Medienmanagement bekräftigt sie, dass der entsprechende Alltag von permanenter Höchstleistung unter Stressbedingungen geprägt ist, was sowohl feinmotorische als auch kognitive Fähigkeiten betreffe. Im Musikalltag stosse man ähnlich wie im Profisport an die Grenzen von Leistungsfähigkeit und körperlicher Belastbarkeit. Damit verbänden sich erhebliche gesundheitliche Risiken. In beiden Branchen bedürfe es jahrelanger Trainings- oder Übeeinheiten, um Spitzenleistungen zu erzielen. Der Alltag sei in beiden damit auch von unregelmässigen Arbeitszeiten, häufigem Reisen und ständiger Selbstkritik geprägt.
Zahlreiche Studien belegen laut der Autorin, wie prekär die gesundheitliche Situation in Orchestern nach langjähriger Berufstätigkeit ist. Es sei zu beobachten, dass Orchestermitglieder bereits im jungen Alter chronische Fehlhaltungen entwickelten. Die Bedeutung von und die Verantwortung für die Gesundheit im musikalischen Berufsalltag nehme aber zu, um nicht zuletzt die Reduzierung von krankheitsbedingen Fehltagen zu erreichen, was unter anderem die Wirtschaftlichkeit von Kultureinrichtungen verbessere. Dass die Berufsgruppe keine kleine, zu vernachlässigende Personengruppe sei, spiegle sich in den Beschäftigtenzahlen wider.
Aktuell gebe es in den deutschen Kulturorchestern laut der Deutschen Orchestervereinigung 9766 Planstellen. Im Gegensatz zu anderen Bereichen, insbesondere dem Sportbetrieb, sei das Thema Schmerzen und Beschwerden bis heute allerdings häufig ein Tabu. Es fehle Wissen und Aufklärung, wie beispielsweise Fehlhaltungen zu vermeiden sind, wie Symptome frühzeitig erkannt werden und welche Therapiemöglichkeiten bestehen. In den letzten Jahren sei das Bewusstsein diesbezüglich geschärft worden, dennoch gebe es angesichts der aktuellen Situation Handlungsbedarf, bei der ein Blick in den Leistungssport lohnend sei.
Die Sportpsychologie hat laut Bregler früh damit begonnen, zu untersuchen, welchen Einfluss Emotionen auf die Wettkampfleistungen haben und wie sie vor, während und nach einem Wettkampf oder Training optimal zu nutzen sind. Sport und Emotionen sind nicht voneinander zu trennen, wie man nach Wettkämpfen oder Fussballspielen auf und neben dem Spielfeld beobachten kann. Wie Auftrittsangst ist auch Wettkampfangst ein Phänomen, das leistungshemmend wirken kann und weit verbreitet ist.
Eine wichtige Komponente zur Vermeidung von Beschwerden ist der Zusammenhang zwischen Erholung und Belastung und seine Auswirkung auf die Leistung. Um kontinuierlich Höchstleistung zu erbringen, ist eine Balance aus Stress und Erholung essenziell. Michael Kellmann, einer der führenden Sportpsychologen unterteilt Vorgehensweisen zur Erholung diffenziert in passive (zum Beispiel Massage), aktive (zum Beispiel lockeres Auslaufen nach einem Wettkampf) und proaktive (zum Beispiel soziale Aktivitäten).
Eine Leistungssteigerung bringt einen gewissen Grad an Erschöpfung mit sich und kann durch ausgiebige Erholungsmethoden kompensiert werden, da die funktionelle Erschöpfung nur eine kurze Leistungsminderung erzeugt. Wird eine systematische und individuelle Erholungsphase nach einem Training oder einer Erschöpfung nicht eingehalten, kann ein andauerndes Ungleichgewicht zwischen Erholung und Überforderung zu einem schädlichen Zustand führen, der sich in anhaltender Untererholung (underrecovery) und dysfunktionaler Erschöpfung (non-functional overreaching (NFO)) äussert.
Für einen Bewusstseins- und Strukturwandel im Orchesterbetrieb ist ein Zusammenspiel auf vielen verschiedenen Ebenen notwendig, angefangen in der musikalischen Ausbildung an Musik- und Musikhochschulen bis hin zum Arbeitsklima im Berufsorchester. Die Praktiken des Leistungssports bieten eine Möglichkeit, erfolgreiche Methoden zu kopieren, zu adaptieren oder entsprechend der Bedürfnisse des Orchesters zu variieren.
Literatur:
Hannah Bregler, 2021, Prävention
für Berufsmusiker:innen als Managementaufgabe. Was der Orchesterbetrieb
vom Profisport lernen kann, München, GRIN Verlag,
> www.grin.com/document/1152272











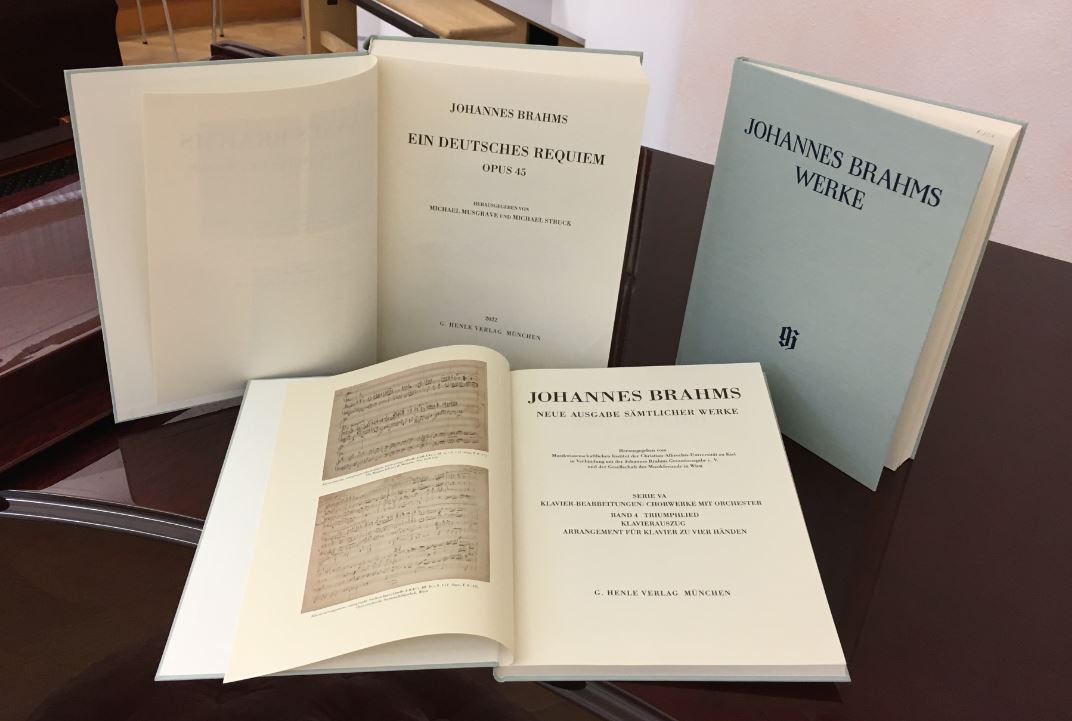



 SMM — Ein Team des Göttinger Max-Planck-Instituts für Dynamik und Selbstorganisation (MPI-DS) und der Universitätsmedizin Göttingen (UMG) ist dem Partikelausstoss und dem damit verbundenen maximalen Übertragungsrisiko beim Spielen von vielen verschiedenen Blasinstrumenten nachgegangen.
SMM — Ein Team des Göttinger Max-Planck-Instituts für Dynamik und Selbstorganisation (MPI-DS) und der Universitätsmedizin Göttingen (UMG) ist dem Partikelausstoss und dem damit verbundenen maximalen Übertragungsrisiko beim Spielen von vielen verschiedenen Blasinstrumenten nachgegangen.