SMM-Symposium zum Musizieren im Alter
Das 12. Symposium der Schweizerischen Gesellschaft für Musik-Medizin SMM und der Schweizerischen Interpretenstiftung SIS widmet sich am 5. Oktober in den Räumen der Hochschule der Künste Bern Aspekten des Musizierens im Alter.
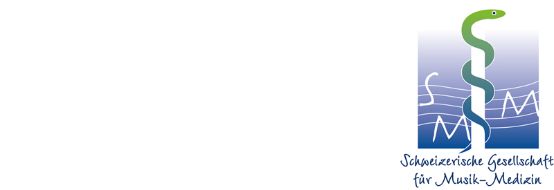
Lange galt die Vorstellung, dass man im Alter kaum noch musikalische Fertigkeiten erwirbt und mit Gewinn nutzt, wenn man sie sich nicht in der Kindheit oder zumindest als junger Erwachsener angeeignet hat. Wie der Zürcher Neuropsychologe Lutz Jäncke am 12. Symposium der Schweizerischen Gesellschaft für Musik-Medizin (SMM) zeigen wird, haben demgegenüber nicht zuletzt Arbeiten zur besonderen Expertise bei Profimusikern zur Einsicht geführt, dass das menschliche Gehirn viel plastischer ist als bislang vermutet, und dies bis ins hohe Alter. Plastizität des Gehirns bedeute auch, so Jäncke weiter, dass der Nichtgebrauch von psychischen Funktionen zu einem neuroanatomischen und neurophysiologischen Abbau führen kann. Vor diesem Hintergrund zeichne sich ein neues und anderes Bild des Alterns, welches viel stärker als bislang vermutet durch selbstinitiierte und selbstkontrollierte kognitive Funktionen beeinflusst wird.
Die Musikjournalistin Corinne Holtz, die das CAS «Musikalisches Lernen im Alter» der Hochschule der Künste Bern leitet, wird berichten, dass ältere Menschen an Musikschulen eine wachsende Zielgruppe mit vielfältigen Potentialen darstellen. Naheliegend ist dabei das Singen in einem Chor. Karl Scheuber, Chorleiter und ehemaliger Studienbereichsleiter ZhdK, wird denn auch aufzeigen, wie sich mit bewusster Ernsthaftigkeit, gegenseitiger Empathie, mit atemtechnischen Hinweisen und der Freude am vielseitigen Schatz unseres vokalen Gedächtnisses ein farbiges Repertoire an Liedern, Sätzen und Klängen neu auf- und ausbauen lässt, das dem Alter angemessen ist. Selbst ein deutlicher Verlust an natürlicher Hörfähigkeit muss dabei kein Hindernis sein. Der Zürcher Hörakustik-Meister Michael Stückelberger wird explizieren, wie mit Hilfe kompetenter Akustiker Hörgeräte so angepasst werden können, dass sie auch zum Genuss von Musik und nicht bloss zur sprachlichen Veständigung taugen.
Hans Hermann Wickel vom Fachbereich Sozialwesen der deutschen Fachhochschule Münster wird die Musikgeragogik, die Disziplin des musikalischen Lernens und der musikalischen Bildung im Alter, vorstellen. Sie will Menschen in allen Lebenslagen des Alters ermöglichen, aktiv und rezeptiv musikalisch partizipieren zu können. Das Spektrum reicht dabei vom Instrumental- und Vokalunterricht über das Musizieren in Chören oder Seniorenensembles sowie die Mitwirkung in intergenerativen Gruppen bis hin zu Musikangeboten für hochaltrige, oder gar multimorbide und dementiell veränderte Menschen.
Das Singen steht auch im Referat von Eberhard Seifert im Zentrum, der als Leitender Arzt Phoniatrie an der Universitäts-HNO-Klinik des Berner Inselspitals wirkt. Er erklärt die physiologischen Grundlagen der Lautbildung und ihre Veränderungen im Laufe des Lebens und wie damit mit Blick auf den Alterungsprozess umgegangen werden kann.
Dass auch eine hervorragende musikalische Leistungsfähigkeit auf Instrumenten bis ins hohe Alter erhalten bleiben kann, sofern keine limitierenden Grunderkrankungen vorliegen, erläutert Maria Schuppert, die als Professorin am Zentrum für Musikergesundheit der Hochschule für Musik Detmold tätig ist, und Hans Martin Ulbrich, ehemaliger Oboist des Tonhalle-Orchesters Zürich, macht darauf aufmerksam, dass es für ehemalige Berufsmusiker darum geht, loslassen zu können. Dies – das wird der frühere Berufsmann auch nicht verschweigen – kann unter anderem schwierig sein, wenn im Alter Armut herrscht und kein Geld da ist, um sorgenfrei zu leben, oder wenn eine Erkrankung zur vorzeitigen Berufsaufgabe zwingt.





