Musik gegen Burnout
Musiker sind vielen Burnout-Risiken ausgesetzt – doch Musik ist auch wirksam gegen Burnout.
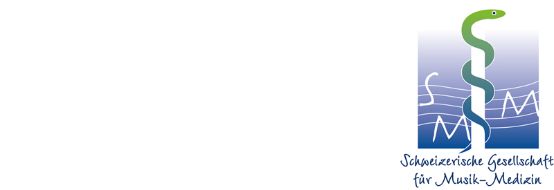
Felicitas Sigrist — Leistungsdruck, Lampenfieber, Konkurrenz, Arbeitsplatzunsicherheit: Im Musikeralltag kumulieren Arbeitsumstände, die als Risikofaktoren für Burnout-Entwicklung wohlbekannt sind. Die Arbeitszeit ist mit Blick auf solche Faktoren weniger relevant als unerfüllte Erwartungen, ausbleibende Anerkennung und zwischenmenschliche Unstimmigkeiten. Oft löst eine Kumulation von beruflichen und privaten Belastungen die Dekompensation aus.
Als Momentaufnahme zeigt sich Burnout als Erschöpfung mit unspezifischen Symptomen auf emotionaler, geistig-mentaler, körperlicher und sozialer Ebene – zum Beispiel Lustlosigkeit, Konzentrationsschwierigkeiten, Infektanfälligkeit, sozialer Rückzug oder Reizbarkeit. Dieser Zustand mündet oft in psychische oder körperliche Folgekrankheiten, meist in eine Depression. Voran geht ein Prozess von Wechselwirkungen zwischen arbeitsbezogenen und personenbezogenen Faktoren. Die äussere Anforderung wird mit der Selbstaufforderung «ich schaff’ das» übernommen – oft unreflektiert. Zwischenmenschliche Konflikte werden vermieden.
Ist eine Herausforderung erfolgreich bewältigt, wird man mit der nächsten, vielleicht grösseren Aufgabe betraut. Werden dazu erholsame Tätigkeiten reduziert, führt dieser Zyklus unweigerlich zur Überforderung. Als Selbstschutz vor Kränkung wird dies nicht anerkannt – hier werden innerseelische Konflikte vermieden. Stattdessen wird die Leistungsminderung mit Einsatzsteigerung beantwortet – also mehr desselben. Bei schwindenden Energien wächst die Aufgabe in der subjektiven Wahrnehmung. Da bei erhöhtem Stress neue Strategien immer unwahrscheinlicher werden, lässt sich diese Burnout-Spirale kaum mehr aufhalten.
Besonders gefährdet sind selbstunsichere, emotional labile Menschen, welche die Aussenwelt als wenig beeinflussbar erleben und bei zunehmendem Stress unflexibel reagieren. Da diese persönlichen Risikofaktoren oft mit früheren Beziehungserfahrungen zusammenhängen, kann Burnout als Resonanzstörung erklärt werden. Einzelpersonen haben wenig direkten Einfluss auf Rahmenbedingungen. Umso wichtiger ist es, souveränen Umgang mit diesen zu pflegen.
Musik ist in mannigfaltiger Weise wirksam gegen Burnout. Gesundheitsfördernde Aspekte der Musik sind wissenschaftlich gut belegt. Für Musiker ist doppelt bedeutsam: zur Selbstfürsorge und bei der Musikvermittlung. Musik beeinflusst Stimmungslage und vegetatives Nervensystem unmittelbar. Sie kann spezifisch sowohl entspannend als auch aktivierend genutzt werden – allerdings nur bei Berücksichtigung der individuellen Musikbiographie. Mit bewusstem Musikhören kann das Erregungsniveau gezielt beeinflussen werden – zur Entspannung, Konzentrationsförderung oder Aktivierung – und somit der Emotionsregulation dienen. Wird Musik jedoch missbraucht, etwa als Aufputschmittel, so kann sie auch in die Burnout-Spirale hineintreiben. Musik als Medizin wird therapeutisch meist als Entspannungsverfahren eingesetzt, um Ruheinseln zu schaffen. Entspannung und eine achtsame Haltung sind Voraussetzungen für neurologische Lernprozesse – auch in psychotherapeutischen Behandlungen.
Aktives Musizieren eignet sich als Ausgleich – sofern es nicht leistungsorientiert ist, sondern erlebnisorientiert bleibt. Neben multiplen biologischen Effekten des Musizierens sind zur Vorbeugung von Burnout besonders die sozialen Aspekte wichtig. Zusammenspiel ermöglicht Begegnungen ausserhalb des Arbeitsumfeldes, unabhängig von der beruflichen Rolle beziehungsweise Identität. Die Erfahrung von Selbstwirksamkeit und Zugehörigkeit sowie die Verbesserung sozialer Kompetenzen stärken die Persönlichkeit. Musikvermittlung, insbesondere im Amateurbereich, hat ihre Berechtigung daher nicht nur der Kunst wegen, sondern auch als wirkungsvolle Prophylaxe.
Schliesslich wird Musik als Medium in der Musiktherapie eingesetzt, die als psychotherapeutisches Verfahren in der Burnout-Behandlung bewährt ist. Kernpunkt ist dabei ein konstruktiver Umgang mit den zwischenmenschlichen und innerseelischen Konflikten, musikalisch gesprochen mit Dissonanzen.
Dr. med. Felicitas Sigrist
… ist Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie FMH, Musik-Psychotherapeutin MAS/SFMT, leitende Ärztin Privatklinik Hohenegg, Meilen bei Zürich, Schwerpunkt Burnout und Belastungskrise.
Literaturhinweis
Sigrist F. (2016) Burnout und Musiktherapie. Grundlagen, Forschungsstand und Praxeologie. Reichert-Verlag, Wiesbaden 2016.





