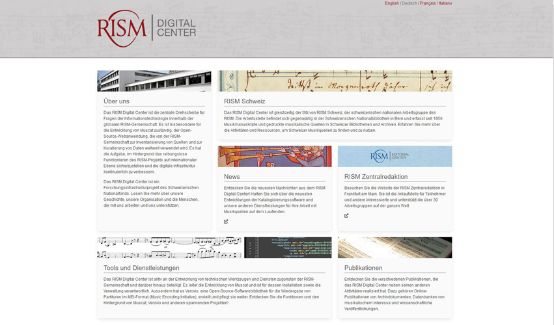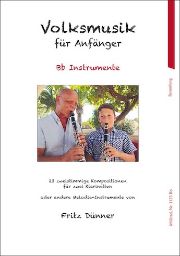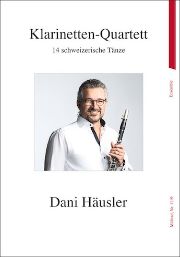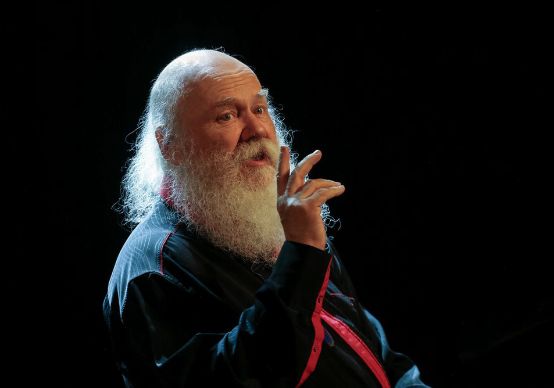Mit Verlegenheit blickten einst viele Beethoven-Biografen auf die Partitur von Wellingtons Sieg oder die Schlacht bei Vittoria op. 91 – nach Alfred Einstein wäre sie gar «der Tiefpunkt im Schaffen». Erfolg und Popularität liessen das musikalische Schlachtengemälde (bestehend aus den zwei «Abteilungen» Schlacht und Siegessinfonie) nicht zuletzt wegen seiner programmatischen Darstellung verdächtig erscheinen. Aus dem Blick gerieten dabei die historischen Rahmenbedingungen, unter denen das Werk entstanden ist.
Mehr als ein Jahrzehnt hatte Napoleon mit seinen Truppen in ganz Europa Militär und Zivilgesellschaft in Unruhe versetzt, als am 27. Juli 1812 die Kunde vom Sieg bei Vitoria endlich Wien erreichte: Lord Wellington hatte bereits am 21. Juni die napoleonischen Truppen nahe der baskischen Stadt in die Flucht geschlagen und die französische Herrschaft über die iberische Halbinsel beendet. Mit diesem Erfolg kehrte unter den angeschlagenen Koalitionskräften der Mut zurück, mit dem sie dann im Oktober des Jahres die Schlacht bei Leipzig gewannen – der Anfang vom Ende Napoleons.
Als am 8. und 12. Dezember 1813 im Wiener Universitätssaal Beethovens Battaglia gemeinsam mit der 7. Sinfonie erstmals erklang, waren zwar längst nicht alle, wohl aber die entscheidenden Schlachten geschlagen. Nur so sind die repräsentative Aufführung und der Erfolg dieses Konzerts zu verstehen, das zum Benefiz der in der Schlacht bei Hanau invalid gewordenen österreichischen und bayrischen Soldaten veranstaltet worden war. Im ca. 100 Mann starken Orchester waren die besten Kräfte der Stadt mit Schuppanzigh als Konzertmeister versammelt, Beethoven dirigierte, der Beifall soll «unbeschreiblich» gewesen sein: «Herrn von Beethovens Ruhm hat sich dadurch aufs neue gegründet; er wurde bei jeder Vorstellung mit Enthusiasmus aufgenommen.» (Wiener allgemeine musikalische Zeitung)
Unrühmlich war indes das Nachspiel. Ursprünglich hatte Beethoven die Siegessinfonie (den zweiten Teil des Werkes) nämlich für Johann Nepomuk Mälzels Panharmonica geschrieben, einen für damalige Verhältnisse sensationellen mechanischen Spielautomaten. Nun hatte Mälzel das Werk aber ohne vorhergehende Rücksprache in München mit Orchester zur Aufführung gebracht und stand auch mit London in Verhandlungen. Da strengte Beethoven ein Gerichtsverfahren über die rechtmässige Urheberschaft an und machte seinen Anspruch in einem Abriss der Entstehungsgeschichte deutlich.
Erst habe er «aus eigenem Antrieb … ohne Geld» die Siegessinfonie für Mälzels Panharmonika geschrieben. Dann wäre dieser auf ihn zugekommen mit dem Wunsch nach einer Ausarbeitung «für ganzes Orchester», was auch umgesetzt worden sei. Er, Beethoven, hätte allerdings schon zuvor die Idee für eine vorangestellte grosse Schlachtmusik gehabt, die musikalisch auf der Panharmonica gar «nicht anwendbar» sei. Mälzel meine fälschlicherweise, Anspruch als «ausschließlicher Eigenthümer dieses werkes» anmelden zu können, da er – sozusagen als Abgeltung – «gehör Maschinen», also Hörgeräte, angefertigt hatte. Diese seien aber «nicht brauchbar genug für mich».
Das Verfahren kam nicht zum Abschluss, zudem haben sich Beethoven und Mälzel später offenbar ausgesöhnt. Wie lange die Schlachtmusik tatsächlich in der öffentlichen Diskussion eine Rolle spielte, zeigt noch 1826 die Besprechung eines Klavierauszugs durch Gottfried von Weber, in der die Siegessinfonie als ein bedeutendes «Tonwerk, – in einem Tonstück von grossen Ansprüchen» bezeichnet wird. Beethoven indes machte während seiner Lektüre genau hier ein Zeichen und merkte fragmentarisch unentschieden an: «gar nicht, nichts als gelegenheitsstück, welches jedoch –»