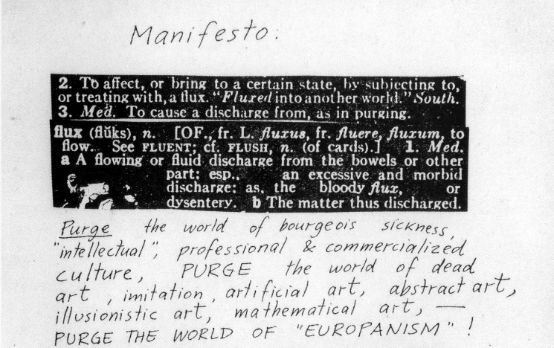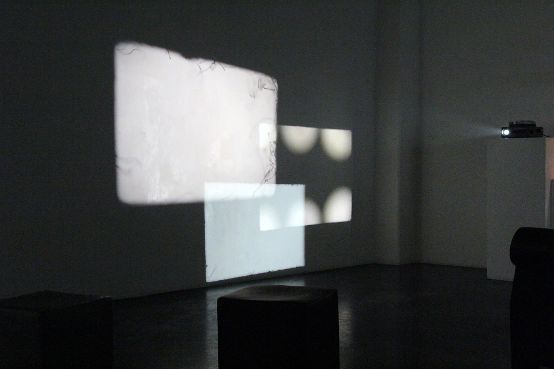Grand Prix Musik für Stephan Eicher
Auf Empfehlung der Eidgenössischen Jury für Musik vergibt das Bundesamt für Kultur den Schweizer Grand Prix Musik 2021 an Stephan Eicher. 14 weitere Musikerinnen und Musiker werden mit einem Schweizer Musikpreis ausgezeichnet.

Die 14 Preisträgerinnen und Preisträger von 2021 sind: Alexandre Babel (Genf), Chiara Banchini (Lugano, TI), Yilian Cañizares, (Havanna, Kuba und Lausanne, VD), Viviane Chassot (Zürich, ZH), Tom Gabriel Fischer (Zürich, ZH), Jürg Frey (Aarau, AG), Lionel Friedli (Moutier, BE), Louis Jucker (La Chaux-de-Fonds, NE), Christine Lauterburg (Bern), Roland Moser (Bern), Roli Mosimann (Weinfelden, TG), Conrad Steinmann (Rapperswil, SG), Manuel Troller (Luzern), Nils Wogram (Braunschweig, D und Zürich).
Stephan Eicher wird 1960 in Münchenbuchsee geboren. Erste Erfahrungen sammelt in einer Electropunk-Band, den Noise Boys. 1981 werden er und seine Band Grauzone mit dem Song «Eisbär» im deutschsprachigen Raum bekannt. Mit dem Album «Les Chansons Bleues» (1983) beginnt sein Erfolg in Frankreich. In seiner Karriere hat Stephan Eicher bisher rund zwanzig Alben veröffentlicht, zuletzt «Homeless Songs» von 2019. 2021 stellt er in einer Tournee sein Projekt «Das Floss der Unnötigen» vor.
Das BAK mandatiert jährlich rund zehn Expertinnen und Experten aus dem Bereich Musik. Diese schlagen Kandidatinnen und Kandidaten aus allen Regionen der Schweiz und aus sämtlichen Musiksparten vor. Ihre Auswahl wird anschliessend der Eidgenössischen Jury für Musik unterbreitet. Im Januar 2021 haben die sieben Mitglieder der Jury den Preisträger des Schweizer Grand Prix Musik sowie die 14 Preisträgerinnen und Preisträger der Schweizer Musikpreise bestimmt. Der Schweizer Grand Prix Musik ist mit 100 000 Franken dotiert, die Schweizer Musikpreise mit je 25 000 Franken.
Fotonachweis: Eddy Berthier, Brüssel / wikimedia commons CC0 1.0