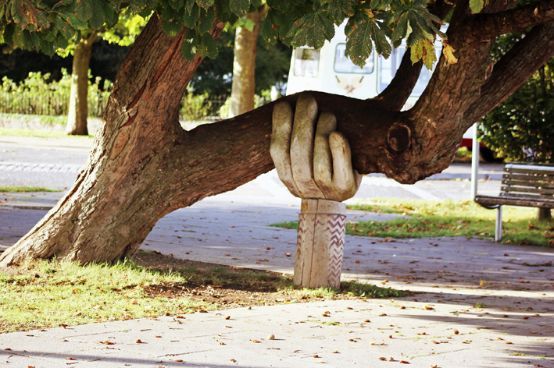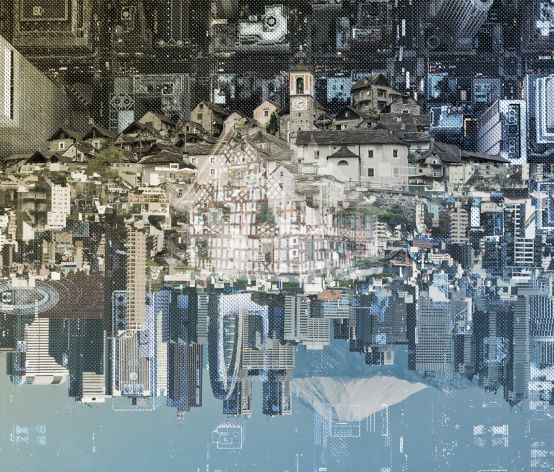Georg Rudiger: Letztes Jahr wurde das Menuhin-Festival in Gstaad abgesagt. Nun haben Sie am 16. Juli als diesjähriger «Artist in Residence» in der gut besetzten Kirche Saanen das Eröffnungskonzert gespielt. Wie war das für Sie?
Daniel Hope: Wunderschön. Die Kirche Saanen ist für mich ein sehr besonderer Ort, weil ich hier als Kind meine ersten Konzerte gehört habe mit Yehudi Menuhin, mit dem Züricher Kammerorchester und vielen anderen. Hier bin ich zu Hause. Nach dieser langen Zwangspause gemeinsam mit meinen Freunden an diesem Ort musizieren zu dürfen, berührt mich sehr. Der ganze Tag war für mich emotional. Heute Morgen fand hier noch die Trauerfeier für den verstorbenen Verwaltungsratspräsidenten und Mitbegründer des Festivals Leonz Blunschi statt, auf der ich auch gespielt habe.
Wie hat das Menuhin-Festival Ihre Musikbegeisterung beeinflusst?
Die Fülle an Talent und Inspiration, die von Yehudi Menuhin und seinen Freunden ausging, ist unvorstellbar. Es gab die Camerata Lysy des grossen argentinischen Geigers Alberto Lysy, aber auch Grössen wir Stéphane Grappelli, Mstislaw Rostropowitsch oder Ravi Shankar gingen ein und aus. Alle haben hier in dieser Kirche gespielt. Das hat mein Leben mit Musik infiziert.
Was macht für Sie das Festival in seiner heutigen Form aus?
Es ist viel grösser und viel breiter aufgestellt als früher – da hat Intendant Christoph Müller mit seiner visionären Kraft hervorragende Arbeit geleistet. Für mich sind aber nach wie vor die intimen Kammermusikkonzerte in den Kirchen im Saanenland das Herzstück des Festivals – und nicht die grossen Orchesterkonzerte im Festivalzelt.
Bei der Programmgestaltung Ihrer drei Konzerte hatten Sie freie Wahl. Die Werke sollten nur mit dem Festivalmotto «London» zu tun haben. Sie haben sich für Programme entschieden, bei denen auch der Gesang wichtig ist.
Ich versuche in meinen Konzerten immer, eine Geschichte zu erzählen und nach Verbindungen zwischen den Stücken zu suchen. Heute Abend war Edward Elgar die thematische Klammer, dessen Violinkonzert der 16-jährige Yehudi Menuhin im Jahr 1932 als Einspringer für Fritz Kreisler gespielt hat. Im nächsten Konzert mit dem Leipziger Vokalensemble Amarcord machen wir eine Zeitreise durch 500 Jahre englische Musik, von William Byrd und Thomas Tallis bis zur Musik von heute. Und beim Konzert mit meinem Freund Thomas Hampson wird englische Volksmusik eine besondere Rolle spielen.
Seit 2016 sind Sie der musikalische Leiter des Züricher Kammerorchesters (ZKO), das auch häufig in Gstaad zu Gast war. Was macht das Orchester aus?
Es ist ein Meisterensemble – jede und jeder Einzelne strahlt eine enorme Leidenschaft für die Musik aus, aber zusammen sind wir am stärksten. Wir machen Kammermusik auf grosser Bühne. Das ist das erste Orchester, das ich in meinem Leben gehört habe. Ich habe nie zu träumen gewagt, es viele Jahrzehnte später leiten zu dürfen.
Die neue Saison steht unter dem Motto «Metamorphose». Wie wird sich das Orchester verwandeln?
Wir haben wohl alle in der letzten Zeit eine Verwandlung durchgemacht. Es war mir wichtig, einzelne Musikerinnen und Musiker des Orchesters zu präsentieren, weil sie alle etwas zu sagen haben – deshalb gibt es viele Doppelkonzerte oder Concerti grossi. Und wir wenden uns Amerika zu, das sich während der letzten zwölf Monate ebenfalls stark gewandelt hat; mit diesem Programm haben wir auch soeben ein Album eingespielt (Anm. d. Red. erscheint bei Deutsche Grammophon). Mit unserem neuen fünftägigen Festival (Anm. d. Red. «Fantasien», 24. bis 28. Juni 2022) werden wir noch stärker in der Stadt präsent sein.
Wie Yehudi Menuhin haben Sie keine Berührungsängste mit anderen Musikstilen. Das ZKO gibt auch zwei Konzerte mit dem Schweizer Popmusiker Marc Sway und spielt Filmmusik. Gibt es Stimmen im Orchester, die Crossover-Projekte kritisch sehen?
Solange die Projekte mit grosser Sorgfalt ausgesucht werden, ist das Orchester gerne dabei. Wir hatten jetzt mit Till Brönner einen grossartigen Jazztrompeter zu Gast, mit dem wir mehrere Auftragskompositionen uraufführten. Im März 2022 werden wir Moby Dick in einem inszenierten Konzert mit Projektion und Tanz auf die Bühne bringen. Die Musik dazu hat Caroline Shaw geschrieben.
Mit dem ZKO spielen Sie auch regelmässig in der Dresdner Frauenkirche, wo Sie seit drei Jahren als künstlerischer Leiter ebenfalls die Konzerte programmieren. Welche Vorgaben haben Sie dort?
Ich bin zuständig für alle klassischen Konzerte in der Kirche. Die Kirchenmusik betreut unser Kantor. Gleich in meinem ersten Jahr habe ich eine Konzertreihe in der Unterkirche für junge Künstlerinnen und Künstler kreiert, die sehr gut angekommen ist. In der grossen Kirche gibt es rund 30 oder 35 Konzerte pro Jahr, die ich programmiere.
Welche Rolle spielt dabei dieser spezifische Ort?
Es ist kein normaler Konzertort – das ist mir sehr wichtig. Die Frauenkirche steht allen Religionen offen. Hier wird immer der Dialog, der Diskurs gesucht. Es gibt sehr viele Treffen von Denkern, Schriftstellern, Philosophen, Menschenrechtsaktivisten. Die Frauenkirche ist ein Ort des Austauschs, des Nachdenkens und der Versöhnung, gerade zwischen England und Deutschland, zwischen Coventry und Dresden, deren Kirchen im Zweiten Weltkrieg zerstört wurden. Die klassische Musik ist Teil dieses Prozesses. Sie öffnet die Seele der Menschen.