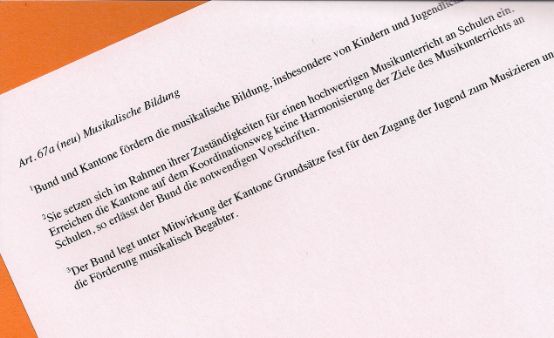Komponisten und Musiker haben bereits vor Jahren begonnen, Handys als Musikinstrumente einzusetzen, etwa Golan Levin in Dialtones: A Telesymphony (2001). Mit dem gleichen musikalischen Material, Klingeltönen und Tastengeräuschen, führten Lars Oberhaus und Marcus Zihn Klangexperimente in Schulprojekten durch. (Anm. 1) Die dabei entstandenen Musikstücke hatten vorwiegend konzeptionellen Charakter. (Anm. 2) Auch Forschungsinstitutionen, allen voran das CCRMA (Center for Computer Research in Music and Acoustics) der Stanford University, widmeten sich früh den Mobilgeräten. In Kalifornien wurde schliesslich eines der ersten Ensemble, das MoPhO (The Stanford Mobile Phone Orchestra, 2007-2010) gegründet, in dem Wissenschaftler und Studierende auf Smartphones musizierten.
Smartphones werden durch Mobil-Prozessoren und grossformatige Displays zu computerähnlichen Universalgeräten im Taschenformat. Integrierte Sensoren ermöglichen die Bedienung via Multi-Touch-Screen, GPS oder Mikrofon. Jeder dritte Deutsche besitzt heute bereits ein Smartphone. Spätestens in zwei Jahren dürften Handys ohne Bildschirmsteuerung weitgehend vom Markt verschwunden sein. Smartphones und Tablets bieten sich als Kommunikations-, Spiel- oder Lesegeräte und nicht zuletzt als Musikinstrumente an.
Mit Händen greifbar ist schon jetzt die spezifische Dynamik zwischen den Beteiligten, die gemeinsam nach Möglichkeiten eines neuen kreativen Umgangs mit Musik suchen. Bis heute kommen Musik-Apps zwar vor allem im Hobbybereich zur Anwendung. Eine Reihe von YouTube-Videos dokumentiert die Experimente von Laienmusikern mit einfachen Klavier-, Gitarren- oder Schlagzeug-Applikationen, die nur rudimentär ihre instrumentellen Vorbilder nachbilden. Doch neuartige Konzepte und die stetige Weiterentwicklung der Instrumenten-Anwendungen wecken auch in zunehmendem Masse das Interesse von Profi-Musikern wie Jordan Rudess. Mit Smartphones und Tablets gespielte Musik-Apps sind mitunter auch auf der Bühne zu hören.
Neben den etablierten Softwareschmieden und Herstellern von Musikinstrumenten (Yamaha oder Korg) sind es in erster Linie Hobby-Programmierer, die Musik-Apps entwickeln. Der Vertrieb wird über App Stores von Apple (iOS), Google (Android) oder Microsoft (Windows 8) über das Internet abgewickelt. Interessenten steht ein grosses Instrumentarium zur Verfügung, für Apple-Geräte derzeit über 12 000, für andere Plattformen weit weniger, ungefähr 400 solcher Musik-Apps. Eine wichtige technische Grundlage um mit Apps wie mit einem Instrument zu musizieren, stellt der verzögerungsfreie Klang dar, den bisher nur iOS bieten kann. Für Android und Windows 8 sind entsprechende Voraussetzungen angekündigt, so dass auch für diese Plattformen ein erweitertes Angebot zu erwarten ist.
Was macht Apps so interessant?
Die künstlerische Praxis mit Musik-Apps ist zwar noch jung, das Interesse an innovativen Anwendungen dagegen hoch, wie die Popularität einschlägiger Videos zeigt. Was aber fasziniert die Leute an Musik-Apps? Aufschluss hierüber geben die vielfach kommentierten Musik-Videos und Blogbeiträge wie auf Palm Sounds. (Anm. 3) Im Folgenden beziehe ich mich auf die Kommentare zu den beiden Musik-Apps TableDrum und Impaktor.
Mit der App TableDrum (Anm.4) kann jeder beliebige Klang, ob Trommeln auf der Tischplatte oder Klopfen gegen ein Metallobjekt, mit dem digitalen Gerät synchronisiert und mit frei wählbaren Drum Soundsverlinkt werden. Auf diese Weise lässt sich ein virtuelles Drum Set spielen, ohne noch auf der Geräteoberfläche selbst herumtippen zu müssen. Das auf diese Weise gespielte Schlagzeug, kann über Kopfhörer gehört werden. Dieses Prinzip der akustischen Steuerung von digitalen Samples wird in der App Impaktor um Syntheziser-Elemente erweitert. Die Möglichkeit, Klänge und Geräusche aufzunehmen und gesampelt einzusetzen, verspricht zusätzliches kreatives Potenzial.
In den Blog-Kommentaren bringen Nutzer vor allem ihre Lust am Experimentieren und ihre Freude, etwas Neues auszuprobieren, zum Ausdruck. Selbst wenn einige an der tatsächlichen Spielgenauigkeit oder dem tatsächlichen Nutzen dieser von Geräuschen gesteuerten Apps zweifeln, heben sie hervor, dass sie innovative Ideen unterstützen und Interesse an ihrer Fortentwicklung haben. In Expertengesprächen werden auch Stärken und Schwächen dieser Musik-Apps diskutiert, Musikstücke analysiert, Vergleiche zu früheren Anwendungen angestellt und mögliche technische Alternativen diskutiert.
Wie ein Leitprinzip zieht sich durch alle Auseinandersetzungen das Element des Erkundens und des Selbermachens. Die Musik entsteht in Interaktion mit dem Medium. Nutzer wollen sich musikalisch kreativ betätigen, mit beherrschbaren Herausforderungen konfrontiert sein und Erfolgserlebnisse verspüren. Für App-Entwickler liegt daher die Herausforderung vor allem darin, ihnen leicht zu bedienende Instrumente in die Hand zu geben. Das Klangresultat soll qualitativ gut und gleichzeitig unterhaltsam sein. Erfolgreiche Apps bieten darüber hinaus die Möglichkeit, eigenes Klangmaterial zu integrieren und Musikproduktionen zu exportieren, um sie an Freunde zu verschicken oder im Internet zu veröffentlichen.
Innovation statt digitaler Nachahmung
Die bisher erfolgreichste Musik-App ist GarageBand für iPad, von Apple zum Release des iPad 2 vorgestellt und seitdem gezielt zu Promotionszwecken eingesetzt. Ausgestattet mit Musikinstrumenten wie Gitarre, Schlagzeug oder Keyboard sowie Sampler, Sequenzer und Effektgerät, zeichnet sich diese App vor allem durch ihre umfangreichen Funktionen aus. Durch die konzeptionelle Ausrichtung der gebotenen Instrumente an den realen Vorbildern zeigen sich jedoch rasch Grenzen, beispielsweise in den eingeschränkten Spieloberflächen oder bei der Visualisierung von mechanischen Abläufen wie dem Schwingen von Saiten, die haptisch nicht erfahrbar gemacht werden können. Bedauerliche Schlussfolgerung: Die App ähnelt einem richtigen Instrument, nur dass sie viel weniger kann. Statt innovative Konzepte zu entwickeln, die sich an den Gegebenheiten des digitalen Gerätes orientieren, strebten die Programmierer dem Spiel und Klang der Originalinstrumente nach, ein Anspruch, der zwangsläufig scheitern muss. Das Musikmachen mit Musik-Apps darf deshalb keinesfalls auf Erfahrungen mit der App GarageBand für iPad reduziert werden.
Meiner Einschätzung nach stellen mobile Technologien wie Smartphones und Tablets für die Musikpraxis einen radikalen Entwicklungsschritt dar. Schwierigkeiten bei der Realisierung von präzisen Klangvorstellungen sowie Hürden bei der Implementierung von vertrauten Instrumenten oder Spielweisen sollten als Aufruf verstanden werden, andere Wege der Klangsteuerung und neue Prinzipien der musikalischen Strukturierung zu finden. Wenn die Besonderheiten und Stärken eines neuen Mediums konsequent genutzt werden, entstehen Kunstformen, die mit herkömmlichen Mitteln nicht realisierbar gewesen wären. Ein Trend ist, dass es sich beim Umgang mit Musik-Apps um individuell an die persönlichen Bedürfnissen und Fertigkeiten der Nutzer ausgerichtete musikalische Praxisformen handelt, die Smartphones zu «Gebrauchsinstrumenten» machen. Sie eröffnen dem Nutzer durch flexible Kombination verschiedener instrumentaler Konzepte eine Vielfalt spielerischer Anwendungen sowie kreativer Ausdrucksmöglichkeiten.
Musikalischer Ausdruck dank Sensoren
Aus der Vielzahl an verfügbaren Musik-Apps erlaubt letztendlich nur ein kleiner Teil, gestalterisch mit Musik umzugehen. (Anm. 5) Welche Apps aber machen Smartphones und Tablets zu digitalen Musikinstrumenten?
Zur Beantwortung dieser Frage möchte ich hier den Aspekt der Körpererfahrung beim Spielen eines Instrumentes näher betrachten. Die Körperbewegung kann beim Musizieren mit mobilen Digitalgeräten mindestens eine ebenso grosse Rolle wie beim traditionellen Musizieren spielen. Hierfür werden digitale Sensoren benötigt. Das sind technische Bauteile, die bestimmte physikalische Eigenschaften der Umgebung erfassen und in digitale Daten umwandeln. Je nach Programmierung können Musik-Apps diese Daten unterschiedlich interpretieren und geben dem Nutzer ein Feedback in Form eines akustischen Ereignisses oder einer Klangmodulation.
Smartphones und Tablets verfügen, verglichen mit Laptops oder Computern, über eine grosse Zahl von eingebauten Sensoren. Zum Musizieren eignen sich, neben der Bildschirmsteuerung per Touch, das Mikrofon, ein Beschleunigungssensor in allen drei Achsen, ein digitaler Kompass, die Digitalkamera und ein Gyroskop, das die Lage des Gerätes im Raum erfasst. Dadurch ist es möglich, Hör- und Seherfahrungen sowie taktile oder gestische Aktivitäten einzubeziehen. Um die Funktionalität einzelner Sensoren zu verdeutlichen, sei hier eine Auswahl an spezialisierten Musik-Apps (für iOS) vorgestellt:
- Das Multi-Touch-Display findet eine anspruchsvolle Anwendung in der App Pitch Painter. Mit dem Finger kann man grafische Partituren erstellen und diese anschliessend erklingen lassen.
- Die integrierte Kamera ermöglicht, virtuelle Musikinstrumente zu steuern, was in der App AirGuitar ausgenutzt wird. Man kann Luftgitarre spielen und diverse Akkorde greifen.
- Der Erschütterungssensor kommt häufig in Schlagzeug-Apps zum Einsatz. In Samplodica lassen sich ausgewählte Samples durch Schüttelbewegungen steuern.
- Das Gyroskop misst die Lage des Smartphones. Die App GyroSynth verwandelt das Smartphone in eine Art «Klanghandschuh», indem die Ortsveränderung zur Klangmodulation genutzt wird. So können musikalische Parameter wie Lautstärke, Tonhöhe oder Filtereinstellungen durch Dreh- und Kippbewegungen kontrolliert werden.
- Das Mikrofon erfüllt in einigen Musik-Apps die Funktion eines Blas-Sensors. Über die Lautstärke der Atemluft am Mikrofon wird die der Ton gesteuert. Die App Wivi Band verfügt über 15 modulierte Blasinstrumente wie Trompete, Saxofon oder Klarinette.
- Der digitale Kompass wird in der App Sound Wand dazu verwendet, über die räumliche Orientierung die Tonhöhe zu steuern.
Einige Musik-Apps wie ThumbJam kombinieren verschiedene Sensoren miteinander. Je mehr Sensoren dazu verwendet werden, Klänge bewusst zu steuern, umso musikalischer wird letztendlich die Anwendung. Die intuitive Steuerung von Musikinterfaces durch Sensoren steigert das Musikerlebnis. Darüber hinaus wird Musizieren auch für neue Zielgruppen verfügbar gemacht, insbesondere für Menschen ohne musikpraktischen Hintergrund oder mit körperlichen Einschränkungen.