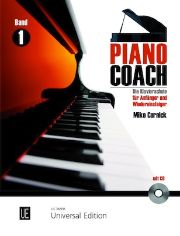Minimalistische Auslegung in Basel
Die Fachschaften Musik in Basel-Stadt und Basel-Landschaft wehren sich gegen einen faktischen Abbau des Musikunterrichts auf der Sekundarstufe I. Moniert wird unter anderem, Musik und Bildnerisches Gestalten würden durch die Verschiebung in den Pflichtwahlbereich massiv abgewertet, was dem neuen, vom Stimmvolk angenommenen Bundesverfassungsartikel zur musikalischen Bildung zuwiderlaufe. Im Basler Volkshaus wurde am 27. Februar dieser Abbau diskutiert.

Wer glaubte, die überaus deutliche Zustimmung der Stimmbürger zum Verfassungsartikel musikalische Bildung im vergangenen Herbst hätte die zukünftige Stellung des Fachs Musik an den Basler Schulen gestärkt, wird durch die aktuelle Planung der Kantone Basel-Stadt und Basel-Landschaft im Zuge der Umsetzung von HarmoS eines Besseren belehrt. Im Gegenteil: Der Musikunterricht wird vor allem in Basel-Stadt massiv reduziert und auf der Sekundarstufe zum (abwählbaren) Nebenfach heruntergestuft. Zudem sollen in Basel-Stadt die musikalischen Grundkurse der Ägide der Musik-Akademie entzogen werden, obschon sich dieses Modell über 40 Jahre bestens bewährt hat.
Grundkurslehrpersonen: Zuständigkeit neu bei der Volksschule
In Basel-Stadt standen die Grundkurslehrpersonen bis anhin, einzigartig in der Schweiz, unter der direkten Aufsicht der Musik-Akademie. Stephan Schmidt, Direktor der Musik-Akademie Basel verwies auf die langjährigen guten Erfahrungen mit dem jetzigen Modell und warnte vor einem absehbaren langfristigen Qualitätsverlust; müssten die Lehrpersonen in Zukunft auch andere Fächer unterrichten, würde sich kaum dieselbe Qualität erreichen lassen wie mit «Nur»-Musikern, die zudem auch hoch motiviert seien, ihr Fach zu unterrichten. Benno Graber vom Baselbieter Amt für Volksschulen erwiderte, diese Befürchtungen hätten sich in Baselland nicht bewahrheitet und betonte den Vorteil der Integration der Musiklehrpersonen in die jeweilige Schulhauskultur, den Kontakt zu den Kolleginnen und Kollegen. Ausserdem könne bei Bedarf eine Nachdiplomausbildung in Musik absolviert werden. Schmidt relativierte: Ein kürzeres Nachdiplomstudium könne auf keinen Fall eine fundierte Ausbildung wettmachen. Ein grundsätzliches Problem ortete die Runde in der Lehrerausbildung selbst, wo Musik abgewählt werden kann.
Paris-Stipendien für Musikschaffende
Das Berner Amt für Kultur schreibt 2014 fünf kulturelle Auslandstipendien in New York, Paris und Berlin aus. Musikschaffende können sich für zwei sechsmonatige Aufenthalte in Paris bewerben.

Für professionelle Berner Musikschaffende werden nächstes Jahr zwei Auslandstipendien in Paris vergeben. Die Künstler sind eingeladen, entweder vom Januar bis Juni oder vom Juli bis Dezember 2014 im möbilierten Studio des Kantons Bern in der Cité Internationale des Arts zu verbringen. Neben der freien Unterkunft umfasst das Stipendium einen monatlichen Betrag von 3000 Franken an die Lebenshaltungs- und Reisekosten. Das Stipendium ist nicht für den Aufenthalt mit Kindern geeignet.
Voraussetzung für die Zulassung zur Jurierung ist ein professioneller Leistungsausweis, gesetzlicher Wohnsitz und/oder professionelle kulturelle Tätigkeit seit mindestens zwei Jahren im Kanton Bern. Die Bewerbungen sind bis spätestens am 30. April 2013 einzureichen und werden von der Musikkommission juriert. Die Unterlagen sind auf der Website des Amtes für Kultur verfügbar:
Kontakt: lejla.sukaj@erz.be.ch
Luft — flüchtiges Betriebssystem des Klangs
Stockhausens «Helikopterquartett» führt uns in windige Höhen, wir lassen die Zukunftsorgel brausen, betrachten eine Methode zur Verbesserung der Stimme über den Atem und fragen uns, ob dörflichen Blasmusiken langsam die Luft ausgeht.


Stockhausens «Helikopterquartett» führt uns in windige Höhen, wir lassen die Zukunftsorgel brausen, betrachten eine Methode zur Verbesserung der Stimme über den Atem und fragen uns, ob dörflichen Blasmusiken langsam die Luft ausgeht.
Focus
Luft von anderem Planeten
Als die Musik fliegen lernte …
L’orgue risque-t-il de manquer d’air ?
Quelle place pour le roi des instruments dans la société actuelle ?
Klänge aus der Zukunft
Ein packendes Hörerlebnis; Hörbeispiele
« Nous avons tous une belle et grande voix ! »
La pneumaphonie met le corps entier au service de la voix.
Alle bande manca il fiato?
Istruzione musicale e socialità nel nostro mobile presente
«Chi sa respirare, sa ben cantare»
Joseph Sopko, Professor für Phoniatrie, über Stimme, Atem und Luft
und ausserdem
RESONANCE
«Das war schon sehr kurzfristig»
Bodo Friedrich über Änderungen beim Basler Kammerorchester
Querbeet
Wirre Entdeckungsreisen in weit auseinanderliegenden Musikwelten
Minimalistische Auslegung in Basel
Bericht über eine Diskussion zur Umsetzung des Musikartikels
Carte Blanche mit Torsten Möller
CAMPUS
Questionner l’apprentissage de la musique au 21e siècle
Les 11e Journées francophones de recherche en éducation musicale (JFREM)
Eklekto
La percussion dans tous les styles
FINALE
Luftige Stadthymne: Rätsel von Michael Kube
Der Schweizer Jugendchor / Chœur Suisse des Jeunes ist eines von zehn Ensembles aus acht Ländern, das im Mai zur Teilnahme am renommierten deutschen Kammerchor-Wettbewerb Marktoberdorf eingeladen worden ist.
Der 1994 von Hansruedi Kämpfen und Pascal Meyer gegründete Schweizer Jugendchor ist ein jährlich neu konstituiertes Ensemble mit Mitgliedern aus allen Schweizer Landesteilen und Sprachregionen. Er öffnet den jungen Talenten ein Tor zur professionellen Ausbildung.
Träger des Chores sind von Beginn an die Schweizerische Chorvereinigung (SCV) und die Schweizerische Föderation Europa Cantat (SFEC). In Marktoberdorf trifft er vom 17. bis 22. Mai 2013 auf Chöre aus Deutschland, Finnland, Frankreich, Puerto Rico, den Philippinen, Serbien und den USA.
Mehr Infos: www.chorverbaende.de/de/modfestivals/internationaler-kammerchor-wettbewerb-marktoberdorf.html
Globale Musik anno 2012
Ein Buch über die «Weltmusik 2.0» überrascht mit einer erfrischenden collageartigen Aufmachung.

Was geschieht, wenn ein Online-Magazin ein Buch herausgibt? Norient, das Berner Netzwerk für lokale und globale Sounds und Medienkultur, hat sich dieser Aufgabe gestellt und mit Out of the Absurdity of Life eine spannende musikalische Momentaufnahme unserer Welt vorgelegt. Die Herausgeber Theresa Beyer und Thomas Burkhalter bewegen sich darin irgendwo zwischen Wissenschaft, Journalismus und Blogkultur. Weder reiner Bildband noch Aufsatzsammlung oder Monographie ist das Buch alles zugleich: Reportagen, wissenschaftliche Analysen und Interviews wechseln sich mit Songtexten, CD-Covers, Konzertplakaten und Zitatschnipseln ab, mal auf Deutsch, mal auf Englisch. Die reichhaltige Collage ist nicht nur grafisch mit Liebe zum Detail umgesetzt, sie bringt dem Leser und der Leserin auch neue, überraschende Zugänge zu den popkulturellen Musikphänomenen unserer Zeit. Gleichzeitig wird die Aufmachung dem Umstand gerecht, dass sich «Weltmusik 2.0» schon lange nicht mehr nur auf Klänge und Töne reduzieren lässt.
Vom kamerunischen Bikutsi Pop über den kolumbianischen Paartanz Cumbia und den syrischen New Wave Dabke bis hin zur schrillen Partymusik des Voodoohop in São Paolo: Out of the Absurdity of Life porträtiert Facetten und Absurditäten einer globalen Klanggegenwart, fernab der eurozentristischen Ausrichtung der Neunzigerjahre. Das Buch geht der Frage nach, ob es einen speziellen Alpensound gibt, untersucht die Abwesenheit eines Soundtracks zur Occupy-Bewegung und zeichnet die kontroverse Geschichte der Musikethnologie nach. Es diskutiert provokative lateinamerikanische Kopulationstänze und liefert Einblicke in den globalen musikalischen Alltag. Weiter nimmt Norient die eigene Veröffentlichungsform als Online-Magazin kritisch unter die Lupe und thematisiert die post-kolonialen Problematiken der Blogkultur. Ganz analog bleibt das Buch nie und wird so zum eigentlichen YouTube-Guide. Was für das Online-Magazin vital ist, erweist sich auch bei der gedruckten Ausgabe als wertvolle Ergänzung.
Thomas Burkhalter beschreibt die «Weltmusik 2.0» als multi-lokale Pop-Avantgarde. Das Oszillieren der Musikstile zwischen Spass- und Protestkultur macht ein abschliessendes Urteil über Ernsthaftigkeit und Motivationen der Protagonisten oftmals unmöglich. Gerne würde man mehr solch präzise und überblickende Analysen lesen, und man vermisst kurze Zusammenfassungen der wissenschaftlichen Aufsätze. Ansonsten ist Out of the Absurdity of Life aber ein gelungenes und heterogenes Jahrbuch für alle Musikophilen dieser Welt. Wer weiss, vielleicht wagt Norient auch 2013 wieder den lohnenswerten Sprung aus der Onlinewelt auf die Druckmaschine?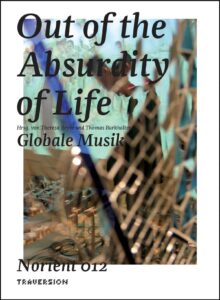
Theresa Beyer und Thomas Burkhalter (Hrsg.), Out of the Absurdity of Life. Globale Musik, 328 S., CHF 36, Traversion, Deitingen 2012, ISBN 978-3-906012-03-2
Zwei Schweizer Popmusiker sind für einen der deutschen Branchenpreise Echo Pop 2013 nominiert. Verliehen wird der Preis am 21. März in den Hallen der Messe Berlin.

In der Kategorie Newcomer International ist der Berner DSDS-Gewinner («Deutschland sucht den Superstar») Luca Hänni nominiert. Er tritt an gegen Alex Clare, Lana Del Rey, Of Monsters and Men und Emeli Sandé. Bei den Swiss Music Awards hat Hänni sich vor wenigen Tagen bereits als Best Breaking Act National gegen Eliane und Müslüm durchgesetzt.
Eine Nominierung in der Kategorie Club / Dance National / International geht an DJ Antoine, den zur Zeit wohl erfolgreichsten Schweizer Popmusik-Export. Seine Single «Ma Chérie» ist eine Million Mal verkauft worden. An den diesjährigen Swiss Music Awards ist er als Nominierter in der Kategorie Best Hit National allerdings leer ausgegangen.
Bild: Mr. Mike, Mad Mark und DJ Antoine im Studio. Stephan Pick, wikimedia commons
Gérald Berger, der Vorsteher des Amts für Kultur bei der Direktion für Erziehung, Kultur und Sport (EKSD) des Kantons Freiburg, wird Ende September 2013 in Pension gehen.
Gérald Berger habe viel dazu beigetragen, dass sich die Kulturszene des Kantons geöffnet habe, grösser, vielfältiger und auch professioneller geworden sei. So seien auch Produktionen entstanden, die über die Kantonsgrenzen hinaus Bekanntheit erringen konnten, schreibt der Kanton. Bergers Name ist unter anderem auch mit der Gründung des Freiburger Kammerorchesters verbunden.
1987 sind in Freiburg das Amt des Dienstchefs und des Generalsekretärs der Direktion für Erziehung, Kultur und Sport (EKSD) getrennt worden. Gérald Berger wurde der erste vollamtliche Vorsteher des Amts für kulturelle Angelegenheiten des Kantons Freiburg, das 2003 in Amt für Kultur umbenannt worden ist.
Es führt seine eigenen Dossiers im Bereich der Kulturförderung. Ihm unterstehen überdies das Staatsarchiv, die Kantons- und Universitätsbibliothek, das Konservatorium, das Museum für Kunst und Geschichte und das Naturhistorische Museum.
Abbau an Schaffhauser Musikschulen verhindert
Die Schaffhauser Legislative hat einer von der Regierung des Kantons geforderten Kürzung der Beiträge an die Musikschulen eine Absage erteilt.
Laut einem Bericht von Radio SRF hat der Schaffhauser Kantonsrat eine Kürzung der Beiträge an die Musikschulen von 275’000 Franken pro Jahr abgelehnt. Der Fehlbetrag hätte künftig von den Eltern der Musikschüler aufgebracht werden müssen.
Der Antrag, auf diese Kürzung zu verzichten, kam dabei nicht aus linken, sondern aus FDP-Kreisen. Der Schaffhauser Stadtrat und Schulreferent Urs Hunziker sprach laut SRF «von einem Bildungsabbau, hinter dem er nicht stehen könne».
Das Aargauer Kuratorium beschloss am 25. Februar, welche der eingegangen Gesuche gefördert werden.
Das Aargauer Kuratorium hat an seiner Februarsitzung insgesamt 779 100 Franken für kulturelle Veranstaltungen gesprochen. Davon sind 152 500 Franken Programmbeiträge für klassische Musikveranstaltungen, 97 000 Franken fliessen als Programm- und Tourneebeiträge in die Sparte Rock und Pop.
Die Listen mit den unterstützten Projekten sind hier aufgeschaltet.
Das Aargauer Kuratorium entscheidet je nach Fachbereich an jährlich zwei bis vier Sitzungen über die Ausrichtung von Beiträgen. Kulturinstitutionen mit Sitz im Kanton Aargau, Aargauer Veranstalter und Aargauer Künstlerinnen und Künstler können ihre Gesuche auch digital eingeben. Weitere Informationen finden sich auf der Website des Kantons Aargau.
Lernbegleiter für jedes Alter
Wie sieht eine Klavierschule des 21. Jahrhunderts aus? Vielleicht wie der «Piano Coach» von Mike Cornick.

Mike Cornick versteht es, mit dieser erfrischend innovativen Klavierschule in zwei Bänden, den Bedürfnissen des heutigen Schülers entgegenzukommen. Erschienen ist sie bei Universal Edition und richtet sich laut Vorwort «an angehende Klavierspieler – ob Jugendliche oder Erwachsene jeder Altersklasse bis hin zum Rentenalter». Dem Autor liegt daran, dem Schüler einen umfassenden Lernbegleiter zur Hand zu geben und zieht dabei alle Register. So ist denn dieses Werk mehr als eine progressive Sammlung von Unterrichtsstücken. Die klar gegliederten Kapitel enthalten jeweils die Aspekte Notation, Spieltechnik, Theorie und Gehörbildung. Was mir daran gefällt, ist die Ausführlichkeit der unterstützenden Textbeiträge und die Sorgfalt des Aufbaus.
In durchaus klassischer Art werden zunächst die Grundlagen des Klavierspiels (Einführung ins beidhändige Spiel, Unabhängigkeit, Parallel- und Gegenbewegung, Imitation, Polyfonie, Akkordspiel etc.) gelegt. Was nun über den üblichen Inhalt einer Klavierschule hinausführt, sind all die expliziten Hinweise zu den oben genannten Aspekten. So kann sich der Schüler oder die Schülerin viele Informationen eigenständig erarbeiten und diese allenfalls mit der Lehrperson diskutieren und vertiefen. Die Spielstücke, zu einem grossen Teil von Mike Cornick selbst komponiert, erstrecken sich von klassischer Musik über Folk bis Jazz. Auf der beigelegten CD finden sich die Aufnahmen der Spielstücke, einige Playalong-Tracks und Übungen zur Gehörbildung. Doch nicht genug, unter universaledition.com/pianocoach1 und /pianocoach2 gibt es weiteres Material zum Gratis-Download: zusätzliche Spielstücke, Akkordtabellen, Dreiklangszerlegungen, Tonarten, Hinweise zur Improvisation. Auch der Leser dieser Zeilen, der ein wenig Piano-Coach-Luft schnuppern will, möge doch diese Seiten anklicken.
Mike Cornick, Piano Coach, Die Klavierschule für Erwachsene und Wiedereinsteiger, Band 1 UE 34991, mit 1 CD, € 19.95, Universal Edition, Wien 2010
id., Band 2 UE 34992, mit 2 CDs, € 22.95, Universal Edition, Wien 2011
Zürcher Studentin gewinnt Warschauer Wettbewerb
Chiara Enderle, Violoncellostudentin im Bachelor Musik an der Zürcher Hochschule der Künste (ZHdK) bei Thomas Grossenbacher, hat in Warschau an der jährlich stattfindenden, international renommierten IX Witold Lutoslawski International Cello Competition den 1. Preis gewonnen.
Neben dem Hauptpreis hat Chiara Enderle auch den Preis für die beste Interpretation des Pflichtstückes und den Award of the European Union of Music Competitions for Youth (EMCY) gewonnen.
Die 1992 geborene Tochter der ZHdK-Musikdozierenden Matthias und Wendy Enderle studiert zur Zeit an der Zürcher Hochschule der Künste, im BA Musik Kunst- und Sportgymnasium, bei Thomas Grossenbacher.
Die Witold Lutoslawski International Cello Competition findet seit 1997 alle zwei Jahre in Warschau statt. Seit Beginn stand sie unter dem Patronat von Mstislav Rostropovich. Für den Wettbewerb ist die Altersgrenze auf 24 Jahre festgelegt und neben einem breiten Repertoire von Barock bis zur Neuen Musik wird als Pflichtstück das Cellokonzert von Witold Lutoslawski verlangt, welches in der 3. Wettbewerbsrunde mit Orchester aufgeführt wird.
«jugend+musik»: Initiativkomitee mit Preis geehrt
In Bern hat Vladimir Ashkenazy als Präsident der Jury den mit 20’000 Franken dotierten 7. Johanna Dürmüller-Bol Young Classic Award der Ständerätin Christine Egerszegi überreicht.

Christine Egerszegi habe als Präsidentin des Initiativkomitees mit ihrem Team viel dazu beigetragen, dass bei der Volksabstimmung vom September 2012 über 70 Prozent für die Einführung des Verfassungsartikels gestimmt haben. Das klare Ergebnis biete allen Kindern und Jugendlichen den Zugang zur Musik, unabhängig von der Dicke des Portemonnaies ihrer Eltern, schreiben die Verantwortlichen des Preises.
Der Johanna Dürmüller-Bol Young Classic Award ist ein gemeinsames Projekt des Festivals Interlaken Classics und der Fondation Johanna Dürmüller-Bol. Der Award wird jährlich an eine Institution verliehen, die sich in besonderer Weise für die Förderung von Nachwuchsmusikern in der Klassik verdient gemacht hat.
Frühere Preisträger sind unter anderen das Davos Festival – young artists in concert, die Sibelius Akademie Helsinki, die Musikschule Konservatorium Bern und der Freundeskreis Anne-Sophie Mutter Stiftung.
Eine konzise Anleitung, um Klarinettenblätter selbst zu bearbeiten oder zu justieren.

Ausrede? Die Blätter mussten schon für so manchen verunglückten Ton und anderes Ungemach von Klarinettisten herhalten! Hanstoni Kaufmann möchte das ändern und hat eine wunderbare Anleitung zum Verbessern von Klarinettenblättern geschrieben. Er blickt dabei auf eine über 30jährige Erfahrung als Blatthersteller und -korrektor zurück: Seit er beim damaligen Soloklarinettisten der Wiener Philharmoniker, Alfred Prinz, angefangen hat, selbst Blätter herzustellen und schliesslich zu Prinz’ persönlichem Blattproduzenten erkoren wurde. Als Kursleiter gibt Kaufmann regelmässig sein Wissen weiter und weiht Klarinettisten in die Geheimnisse ein.
Auf 40 Seiten im A4-Format liefert Hanstoni Kaufmann viele Fakten und allerhand Lehrreiches sowie knappe und äusserst präzise Anleitungen zur Bearbeitung der kleinen Klangerzeuger. Das Heft widmet sich zuerst dem Material, dem Rohrholz mit seinen Eigenschaften, Eigenarten und seinem Schwingungsverhalten. Kaufmann zeigt auf, wie die Blattgeometrie beschaffen sein sollte und wie direkt einzelne Töne einer Region auf dem Blatt zugeordnet werden können. Die Methoden der Bearbeitung werden anhand konkreter Techniken genau erklärt, und der Autor präsentiert das benötigte Werkzeug und dessen Verwendung. Am Ende des Heftes sind zu allen Materialien Bezugsquellen angegeben. Äusserst hilfreich sodann ist das Kapitel «Korrigieren und justieren mit System», welches häufige Blattprobleme und die Möglichkeiten zu deren Behebung angibt. Schliesslich nennt Kaufmann zahlreiche Analyseschritte mit Diagnosen und Korrekturmöglichkeiten.
Klarinettenblätter korrigieren gehört in jede Klarinettisten-Bibliothek, auch wenn man nicht vor hat, sich mit Schleifpapier und Stechbeitel ans Werk zu machen. Alleine schon wegen der interessanten Informationen zu den Blättern und den wunderbaren Abbildungen. Wer sich wirklich selbst an die Arbeit machen will, ist wahrscheinlich gut beraten, zusätzlich einen Kurs beim Autor zu besuchen.
Hanstoni Kaufmann, Klarinettenblätter korrigieren, 40 S., Fr. 29.80, misura Verlag, Luzern 2012, und direkt beim Autor: mhtk@bluewin.ch
Die Kulturförderung der Stadt Zürich stellt ab März 2013 in Etappen auf die Online-Gesuchsstellung um. Die Fördergesuche werden neu über ein zentrales Portal eingereicht und durch die Ressorts und Fachkommissionen elektronisch bearbeitet.
Bei der Dienstabteilung Kultur der Stadt Zürich gehen jährlich rund 1500 Fördergesuche ein; sie werden dort in den verschiedenen Ressorts bearbeitet. Neu wird der gesamte Prozess der Gesuchsstellung und -bearbeitung von der Einreichung bis zum Entscheid auf elektronischem Weg und online über das Internet durchgeführt.
Die Lösung ist für Kultur Stadt Zürich gemeinsam mit der Organisation und Informatik Zürich (OIZ) und einem privaten Anbieter erarbeitet worden. Die inhaltliche Beurteilung der Eingaben erfolgt wie bis anhin durch eine verwaltungsexterne Fachkommission.
Die einzelnen Kultur-Ressorts stellen gestaffelt auf die elektronische Gesuchsstellung um. Ab den folgenden Daten sind Fördergesuche elektronisch und online zu stellen: E-Musik ab 1. März 2013, Jazz/Rock/Pop ab 15. März 2013, Bildende Kunst ab 6. Mai 2013, Theater, Tanz und Literatur ab 1. Juli 2013.
Mehr Infos: www.stadt-zuerich.ch/kultur
Der Regierungsrat des Kantons Thurgau unterstützt das Projekt «Netzwerk Schule und Kultur». Ziel ist es, die Kulturvermittlung in den Schulen zu stärken und damit Kindern und Jugendlichen aller Schulstufen einen erleichterten Zugang zur Kunst und Kultur zu ermöglichen.
Eine Koordinations- und Informationsstelle erhält die Aufgabe, eine Online-Datenbank aufzubauen, die alle Kulturvermittlungsangebote im Thurgau und in seinem Einzugsgebiet auflistet. Das Angebot soll der bereits bestehenden Kulturagenda thurgaukultur.ch angegliedert und mit der geplanten Datenbank weiterer Ostschweizer Kantone vernetzt werden.
Eine zweite Aufgabe der neuen Stelle besteht darin, an den Schulen ein Netzwerk von Kontaktpersonen aufzubauen, die sich besonders um Belange der Kulturvermittlung kümmern.
Für die Dauer der dreijährigen Aufbauphase der neue Stelle — der Regierungsrat hat dafür jährlich 100 000 Franken aus dem Lotteriefonds bewilligt — wird eine Projektgruppe unter der Leitung von René Munz, Leiter Kulturamt, eingesetzt. Für die Projektleitung wird der ausgebildete Primarlehrer und Museumspädagoge Adrian Bleisch aus Egnach im Auftragsverhältnis eingesetzt.