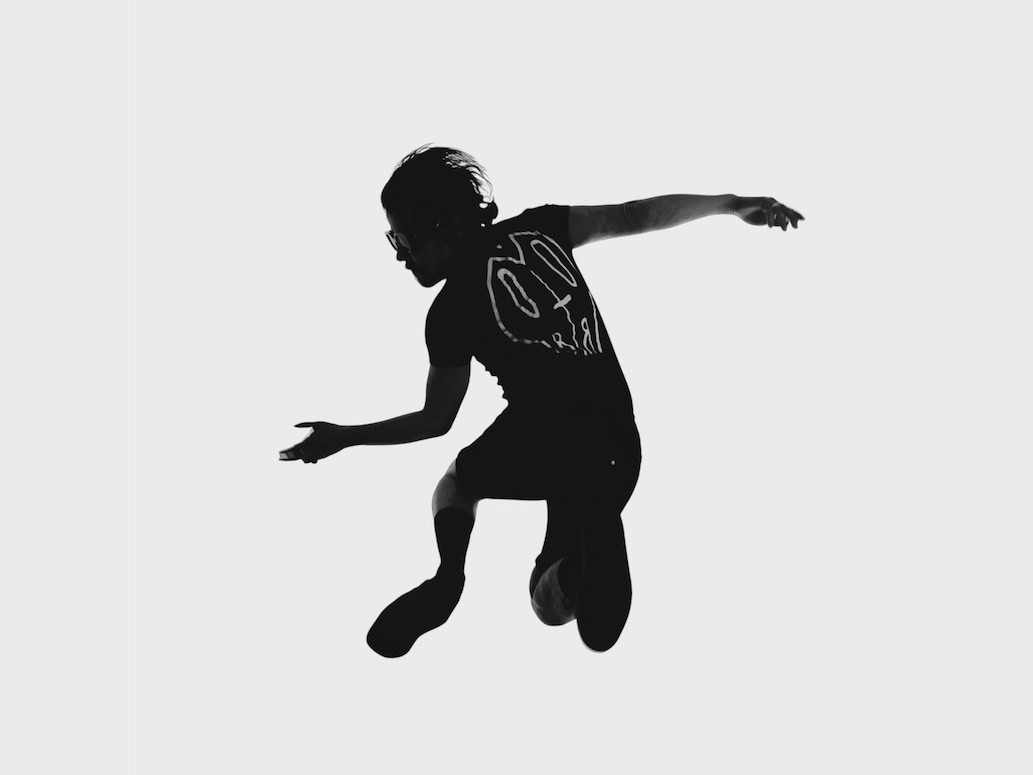Verzichtbare und unverzichtbare Werke
Antonín Dvořák hatte möglicherweise gute Gründe, drei seiner Streichquartette zu vernichten.

Die beiden Streichquartette Nr. 2 (1869?) und Nr. 5 (1873) stehen exemplarisch für das Dilemma der Nachgeborenen in der Frage, welche Werke eines grossen – besonders bereits zu Lebzeiten – respektierten Komponisten als typisch und aufgrund seines Urteils als anerkannt gelten sollen und welche eben nicht.
Über die zerstörerische Selbstkritik von Johannes Brahms und anderen sowie die daraus resultierenden – oft vermeintlichen – grossen Verluste, ist an vielen Stellen gemutmasst und diskutiert worden. Die Vorstellung, dass ein durch zahlreiche Meisterwerke zu Berühmtheit gelangter Komponist einfach immer genial und grossartig gewesen sein müsse, kann man mit Hilfe des gesunden Menschenverstandes nur ablehnen. Selbst Mozart und Beethoven, Garanten scheinbar ewig gültiger Geistesfrüchte mit einem direkten Draht zu göttlicher Inspiration, haben banales, unverbindliches, verzichtbares Notenmaterial produziert, das durchaus allgemeinem Vergessen anheimfallen dürfte, ohne ernstzunehmende Verlustgefühle zu produzieren. Sollte man nicht annehmen dürfen, dass diejenigen, die die besten Kenner ihres eigenen Werkes waren, auch deren absoluten Wert am ehesten beurteilen konnten? Ein Klarinettenquintett von Dvořák, ein Oktett mit Klavier – verloren!! Wir neigen eher dazu, den Verlust zweifelhafter Werke (des Übergangs oder wichtiger Entwicklungsphasen) zu betrauern, als deren Zerstörung durch ihre Schöpfer als notwendigen Reinigungsprozess ihres Gesamtwerkes zu begreifen, durch den die Wertigkeit der übriggebliebenen Werke umso deutlicher wird. Die Neugier verführt uns dazu, nach dem zu suchen, was eigentlich nicht mehr zu erforschen sein sollte.
Dvořáks intensive Auseinandersetzung mit Wagner und Liszt ab 1863 war derart folgenreich, dass er sein eigens Schaffen in den Dienst anderer Geistesgrössen stellte, ohne sich in diesen allzu grossen Schuhen überzeugend bewegen zu können. Drei Quartette (D-Dur, e-Moll, B-Dur) entstanden in dieser Phase der Götzenanbetung, deren Partitur Dvořák später konsequenterweise vernichtete, da er den eingeschlagenen Weg als Irrweg identifiziert hatte. Leider – muss man fast sagen – überlebten Stimmensätze in Privatbesitz, die nun zur Verlegung der Stücke geführt haben, die bei der höchsten Instanz, dem Autor selbst, in Ungnade gefallenen waren. Denn gerade das 50-minütige B-Dur-Quartett mit seinen endlosen thematischen Verflechtungen, seiner halb improvisierten Unfasslichkeit ist ein akustisches Ungetüm und eine Zeitverschwendung ersten Ranges für jeden Interpreten. Als Studienobjekt einer kompositorischen Sackgasse mag es angehen, aber zu mehr taugt es einfach nicht.
Ganz anders das 5. Quartett des aus verblendetem Tiefschlaf erwachten und klarsichtig gewordenen Komponisten. Hier findet Dvořák zu einem individuellen Stil, zurück zu fassbar formalen Leitlinien, einer emotionalen Aussage, Schwung, Verve, Sinnlichkeit. Freilich darf man keines der späteren Meisterstücke an seine Seite stellen, aber freudig das Unbekannte der Partitur im Konzert zum Klingen bringen, sich unvoreingenommen mitreissen lassen und hören, wo die Ursprünge der später unanfechtbaren Meisterschaft wirklich liegen. Dvořák war kein Frühvollendeter, kein Wunderknabe, sondern ein hart arbeitender Musiker, dessen Kampf um den eigenen Ton auch vernachlässigbare Ware produzierte. Das B-Dur-Quartett dürfte weiterhin getrost vor den Augen der Welt verborgen bleiben, das f-Moll-Quartett hingegen gehört öfters auf die Bühne!
Antonín Dvořák, Streichquartett Nr. 2 B-Dur B 17, hg. von Antonín Pokorný und Karel Šolc, Stimmen, BA 9540, € 24.95; Studienpartitur, TP 540, € 18.95, Bärenreiter, Prag 2014
Antonín Dvořák, Streichquartett Nr. 5 f-Moll op. 9, hg. von Jarmil Burghausen und Anton Cubr Stimmen, BA 9545, € 17.95; Studienpartitur, TP 535, € 16.50, Bärenreiter, Prag 2014