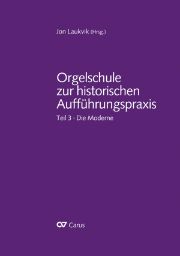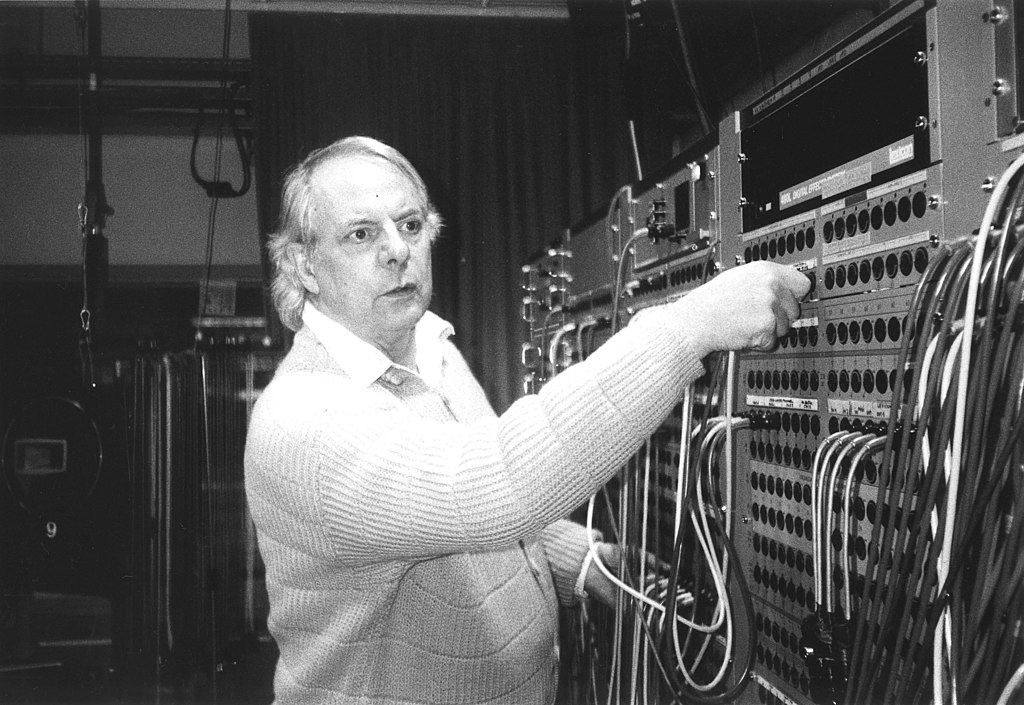Orgelschule für Profis
Der dritte Band von Jon Laukviks Standardwerk zur historischen Aufführungspraxis beschäftigt sich mit der Moderne.

Nach dem Band über Musik des Barocks und der Klassik sowie jenem zur Romantik – bereits zu unumgänglichen Standard-Werken geworden – legt Jon Laukvik, Professor an der Stuttgarter Musikhochschule, nun den dritten und letzten Band seiner Orgelschule zur historischen Aufführungspraxis vor. Es handelt sich dabei nicht um eine Schule im eigentlichen Sinn, die sich an Anfänger richtet, sondern um ein höchst umfangreiches Lehr-, Studien- und Nachschlagewerk für fortgeschrittene Spielende, die darin wertvolle Informationen, Quellentexte und praktische Anregungen zu verschiedensten Aspekten einer historisch informierten Musikpraxis finden, die – im Unterschied zu anderen derartigen Büchern – auch auf die Musik des 19., im vorliegenden Fall sogar des 20. und 21. Jahrhunderts ausgedehnt wird.
Für diesen Band hat Laukvik verschiedene Koautoren für (naturgemäss zum Teil ausgesprochen subjektiv geprägte) Beiträge zu ihren jeweiligen Spezialgebieten verpflichtet. Armin Schoof schreibt zunächst über Neoklassizismus deutsch-österreichischer Prägung am Beispiel von Distler, Hindemith, David und Hessenberg, also von vier Komponisten, deren Ästhetik a priori bereits sehr stark divergiert, während man andere wichtige Namen (Reda, Bornefeld) etwas vermisst. In Jeremy Filsells Beitrag über Marcel Dupré dominiert der «hagiographische» Aspekt zum Teil etwas die kritische Auseinandersetzung mit dieser prägenden, doch auch sehr umstrittenen Figur der frühen Moderne Frankreichs; zudem ärgert man sich über einige Übersetzungs-Stilblüten in diesem sonst ausgesprochen sorgfältig gestalteten Buch («toes» sind im Zusammenhang mit Pedalspiel nicht die Zehen, sondern die Fuss-Spitzen). Hans Fagius’ Beitrag zu Maurice Duruflé gibt einige interessante Einblicke in das Schaffen des selbstkritischen Meisters, ergänzt durch knappe persönliche Erinnerungen an Fagius’ Unterricht bei Duruflé.
Auf fast 150 Seiten folgt sodann der erste Höhepunkt des Buchs, ein von Hans-Ola Ericsson, Anders Ekenberg und Markus Rupprecht verfasster Aufsatz über Olivier Messiaen. Eine allgemeine Einführung vermittelt die wichtigsten Informationen über Leben und Werk des Komponisten, die wichtigsten Parameter seines Komponierens (Rhythmik, Modalität, Harmonik) und seinen Umgang mit dem Instrument Orgel hinsichtlich Registrierung, Artikulation oder Tempowahl. Daran schliessen sich umfangreiche Einzelbetrachtungen der verschiedenen Werke an, die auch ganz praktische, streckenweise vielleicht sogar (zumindest für den französisch geschulten Leser) etwas gar «technisch» anmutende Umsetzungsvorschläge, auch für «stilferne» Instrumente, und wertvolle Übhinweise enthalten. Zusammen mit vergleichbaren Publikationen von Olivier Latry und Loïc Mallié (L’oeuvre d’orgue d’Olivier Messiaen, ebenfalls bei Carus), Jon Gillock (Performing Messiaen’s Organ Music, Indiana University Press) oder der kürzlich verstorbenen Almut Rössler dürfte dieser Beitrag zu einer äusserst wichtigen Informationsquelle bezüglich Messiaen werden, umso mehr, als alle genannten Autoren intensiv mit dem Komponisten zusammengearbeitet hatten.
Guy Bovets Beitrag zu Jehan Alain stützt sich vor allem auf die Erstausgaben seiner Werke aus den Jahren 1939 – 1945, die noch frei sind von späteren editorischen Zusätzen anderer Familienmitglieder (wie die Leduc-Ausgabe von 1971) oder verschiedene Fassungen kompilieren (Bärenreiter), regt also zu einer textnahen Auseinandersetzung mit dem Komponisten an. Mit zwei Aufsätzen von Bernhard Haas, einerseits zur Orgelmusik von Schönberg, Milhaud und Kodály, anderseits zu (nach Schwierigkeitsgrad geordneten) Schlüsselwerken der letzten 60 Jahre erreicht Laukviks Buch dann seinen absoluten Gipfel. Haas’ prägnante und fundierte analytische Bemerkungen, seine von jahrelanger Vertiefung in diese Werke geprägten Arbeits- und Übhinweise, inklusive umfangreicher Textkorrekturen, aber auch die farbige Sinnlichkeit seiner Werkbeschreibungen gehören zweifellos zum Besten, was in den letzten Jahren zum Thema Neue Orgelmusik publiziert worden ist. Mit Kurzkommentaren zu weiteren Werken und einer ergänzenden Liste mit Kompositionen der jüngsten Zeit gelingt Haas zudem eine an Aktualität kaum zu überbietende, nicht auf ein bestimmtes Sprachgebiet beschränkte Werkschau, die man jedem professionellen Orgelspielenden als Pflichtlektüre für persönliche Weiterbildung ans Herz legen sollte.
Fazit: Mit diesem dritten und letzten Band ist die Orgelschule von Jon Laukvik nochmals um ein wesentliches Element bereichert worden und kann in jeder Beziehung als Lese- und Studienbuch empfohlen werden, das in jede Organisten-Bibliothek gehört!
Orgelschule zur historischen Aufführungspraxis – Teil 3: Die Moderne, hg. von Jon Laukvik, 352 S., € 80.00, Carus-Verlag, Stuttgart 2014, ISBN 978-3-89948-227-0