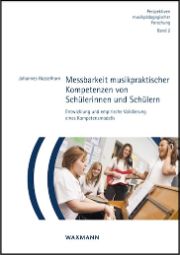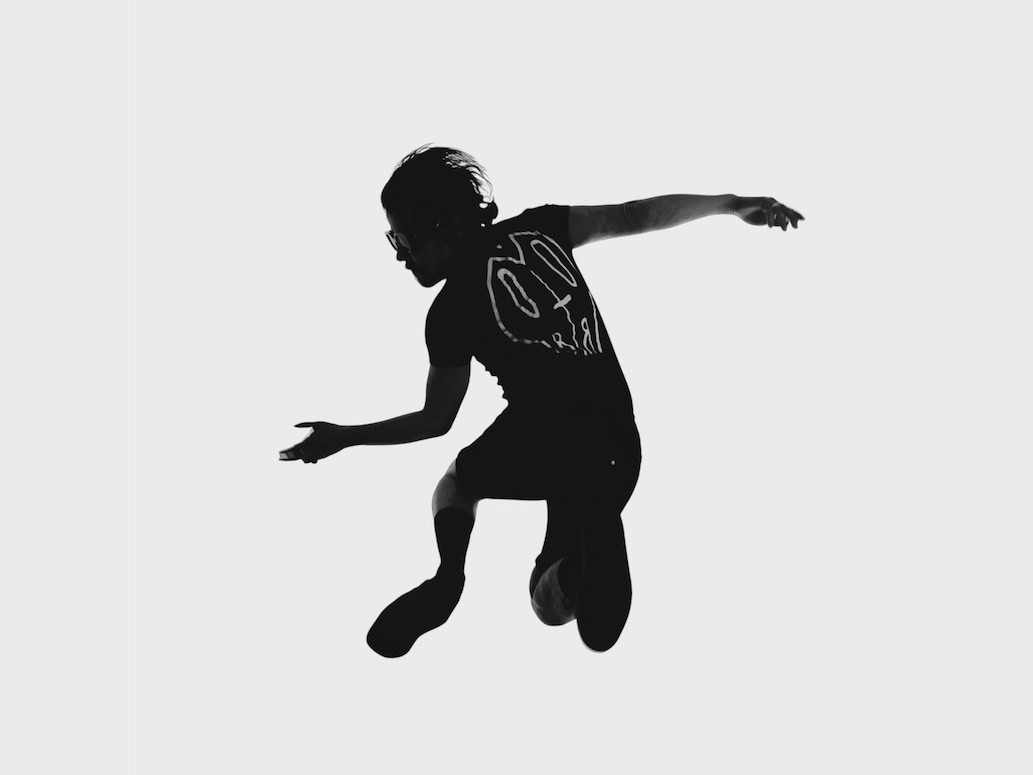Musikpraktische Kompetenzen messen, ja – aber wie?
Ein Modell dazu entwickelt und untersucht Johannes Hasselhorn in seiner Dissertation.
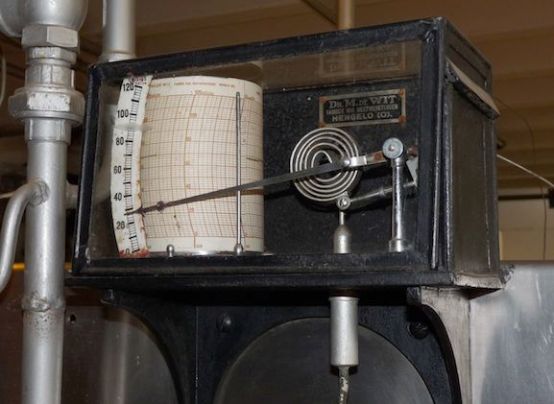
Die Messbarkeit von musikalischen Leistungen ist bei Pädagogen umstritten und doch wird sie im «richtigen Leben» in vielen Bereichen vorgenommen, man denke nur an die zahlreichen Musikwettbewerbe, Castingshows oder an die harten Auswahlverfahren für Studienplätze und Musikerstellen. Hasselhorn stellt sich berechtigterweise die Frage nach der Bewertbarkeit von Leistungen, die neben den genannten Bereichen auch in weiterführenden Schulen gemessen werden müssen. Der Autor konzentriert sich in seinen Untersuchungen auf die musikpraktischen Kompetenzen, klammert also den sowieso schon bewertungsrelevanten theoretischen Musikunterricht aus. Er zielt ebenso wenig auf eine Bildungstheorie für das Fach Musik ab, betont aber, dass ohne klar definierte Bildungsziele für den Musikunterricht sein in akribischer Kleinarbeit hergeleitetes und empirisch erprobtes Kompetenzmodell nur bedingte Aussagekraft haben könne.
Hasselhorn geht in seinem von der Deutschen Forschungsgemeinschaft DFG unterstützten Projekt vom selben Kompetenzbegriff aus, der auch dem Lehrplan 21 zugrunde liegt (Weinert, 2001). «Musikpraktische Kompetenz» sieht er als «eine notwendige Voraussetzung für komplexere musikbezogene Handlungen». Vor diesem Hintergrund entwickelt Hasselhorn zunächst ein theoretisches Kompetenzmodell. Er untersucht bestehende Modelle aus dem angelsächsischen Bereich und vergleicht diese mit Curricula der deutschen Bundesländer auf Sekundarstufe I. Er kondensiert die gewonnenen Erkenntnisse schliesslich in ein dreidimensionales Strukturmodell mit den für die Schule geltenden Musikbereichen: Gesang, instrumentales Musizieren, Rhythmusproduktion. Jeder Dimension ordnet er je drei niveauabgestufte Bewertungsskalen zu. In Zusammenarbeit mit erfahrenen Musiklehrern entwickelte er Testitems (Aufgaben). Zur Erfassung der Messresultate war ein umfangreicher technischer Aufbau vonnöten.
Die Resultate für die untersuchte Jahrgangsstufe 9 zeichnen sich durch eine unerwartete Heterogenität aus und zeigen eine Diskrepanz zwischen den hohen curriculären Ansprüchen und den tatsächlich gemessenen Einzelkompetenzen. Der hierzulande auf kollektive Ergebnisse angelegte Musikunterricht dürfte durch eine geschickte Didaktik aber zu weit akzeptableren Ergebnissen gelangen, als dies die gemessenen Einzelfähigkeiten vermuten lassen. Der Test habe denn auch «nur eine einzige Aufgabe», aber diese erfülle er «in hervorragender Weise (…) nämlich die leistungsstärkeren von den leistungsschwächeren Schülern objektiv, zuverlässig und gültig zu trennen».
Johannes Hasselhorn, Messbarkeit musikpraktischer Kompetenzen von Schülerinnen und Schülern, Entwicklung und empirische Validierung eines Kompetenzmodells, Perspektiven musikpädagogischer Forschung, Band 2, 196 S., € 29.90, Waxmann, Münster 2015, ISBN 978-3-8309-3294-9