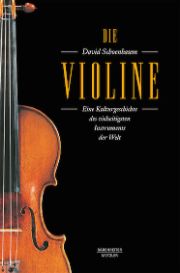Das Who’s who der Violine
David Schoenbaums Kulturgechichte widmet sich auf 730 Seiten den Herstellern, Händlern und Spielern des «vielseitigsten Instruments».

Dieses schwere Buch habe ich während 14 Tagen gestemmt und mit viel Spannung gelesen. Es schlägt mit seinen 2066 Anmerkungen und einem sehr nützlichen Register mit 2400 Namen alle bisher erschienenen Geschichtsbücher über die Violine. David Schoenbaum (geboren 1935 in Milwaukee, USA) hat sich als Historiker einen Namen gemacht mit der Weiterbearbeitung seiner in Oxford entstandenen Dissertation Die braune Revolution: eine Sozialgeschichte des Dritten Reiches, englisch 1966, deutsch 1968/1999. Bis 2008 war er Professor für Geschichte an der Universität von Iowa. Am vorliegenden Buch schrieb der Amateurgeiger 20 Jahre.
Die Kapitel über den Geigenbau, lesen sich wie ein Roman. Man vernimmt erstaunliche Neuigkeiten über den Ursprung der Geige (wobei China und Indien unerwähnt bleiben), die Verbindung über die Alpenpässe und die politischen Einflüsse. Wahres und Legendenhaftes über die Familien Amati, Stradivari und Guarneri wird entwirrt. Der Aufstieg und die gewerkschaftlichen Hintergründe von Mirecourt, die lange Erfolgsgeschichte von Vuillaume, der wegen explodierender Nachfrage den Markt als erster mit günstigen «Stradivari» aus seiner eigenen Werkstatt überschwemmte, die Geschichte des deutschen Geigenbaus von Stainer bis zu den Manufakturen von Markneukirchen werden ausführlich beschrieben, ebenso diejenige von Japan und China. Die Entwicklung des Bogens und dessen berühmteste Bauer sind nur kurz abgehandelt.
Ein 100-seitiger Teil dreht sich um den Geigenhandel: interessante europageschichtliche Hintergründe, die enge Verbindung von Geigenbauer und -händler, der Aufstieg der grossen Handelsimperien Hill, Herrmann und der Auktionshäuser Christie’s und Sotheby’s mit weltweit herumreisenden Experten, die rasenden Preisanstiege (ehemals dienten Handwerkerlöhne, später Herrschaftsvillen als Vergleich), Monografien über Bildupp, Fushi & Bein, Machold, auch über die zwei Händlerinnen Felicity Foresight und Claire Givens, die unglaubliche Anzahl von «Strads» und deren unvorstellbare Irrwege, Verbrechen, Erbschaftsquerelen, Prozesse, auch der wegen Expertenstreit verworren gebliebene «Stradi»-Werro-Prozess, Fortschritte bei der Echtheitsfindung alter Instrumente dank Röntgen-, Pigmentanalyse und Dendrochronologie, die zu Wessels Frage führte, ob sich die Auktionshäuser für etwas erwärmen würden, das «das Bewusstsein dafür schärft, wie viele Fälschungen sie wohl verkauft hatten».
Die 250 Seiten über das Geigenspiel beginnen mit der Aufzählung vieler geigender Berühmtheiten – man staune! Ursprünglich vererbte sich das Geigenspiel vom Vater zum Sohn, wie andere Handwerke auch. In den italienischen Ospedali lernten die Waisenkinder musizieren, um an den vielen kirchlichen und weltlichen Festen ihren Unterhalt mitverdienen zu können. Der Unterricht entwickelte sich von der Geheimlehre von Virtuosen über die Waisenhäuser (= Konservatorien!) zu den staatlichen und berühmten privat gestifteten Instituten weltweit. Lange dauerte der Wandel vom vogelfreien Spielmann über den Hofangestellten zum freien hochverdienenden Künstler. Über Paganini, Viotti, Auer, Stern und viele andere vernimmt man viel Neues. Wettbewerbe sind auch politisch! Die verwirrenden Geschichten der Orchestergründungen sind höchst spannend, darunter die erstaunlichen Erfolge von Jugendorchestern in unterprivilegierten Gegenden. Verlage und Plattenfirmen lechzten nach grossen Interpreten und umgekehrt!
Über die Pädagogik ist nicht viel zu lesen, nur über viele erfolgreiche Hochschullehrende. Gruppenunterricht beginnt 1839 bei Birkbeck in England. Ausführlich wird über Shinichi Suzuki und Roberta Guaspari berichtet, aber von den ebenso grossen Verdiensten Paul Rollands und Sheila Nelsons und von den einflussreichen Vereinen ASTA und ESTA (American resp. European String Teachers Association) steht kein Wort. Von vielen erfolgreichen, schweren und tragischen Künstlerschicksalen wird berichtet; die Vollständigkeit rechtfertigt hier die Bezeichnung «Who’s who». Die späte aber heute gleichberechtigte Einbeziehung der Frauen im Orchester- und Solospiel ist ein wichtiges Kapitel. Die Aufzählungen über die Geige als Allroundinstrument in allen Musikstilen, in bildender Kunst, Poesie, Literatur und Film sind ausufernd, können aber nicht vollständig sein (darf ich ergänzen: Jean Diwo, Les violons du roi; Jaume Cabré, Das Schweigen des Sammlers; Mechtild Borrmann, Der Geiger). Das Buch wäre als Nachschlagewerk noch besser geeignet, wenn im Inhaltsverzeichnis und in den einzelnen Teilenmehr Untertitel stünden.
David Schoenbaum Die Violine: eine Kulturgeschichte des vielseitigsten Instruments der Welt, aus dem Amerikanischen von Angelika Legde, 730 S., Fr. 67.00, Bärenreiter Kassel & Metzler Stuttgart 2015, ISBN 978-3-476-02558-6