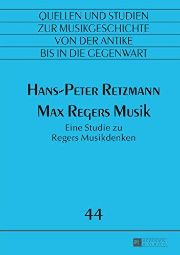Regers Musikdenken
Die imposante Studie von Hans-Peter Retzmann liefert viele anregende Ansätze und prägt Begriffe, um diesen musikalischen Kosmos zu fassen, erscheint aber unfertig.

Max Regers Musik ist nicht einfach zu verstehen. Sie bewegt sich zwischen den Zeiten und ästhetischen Richtungen. Ihr Rang ist auch hundert Jahre nach seinem Tod umstritten. Umso dankbarer ist man, wenn ein intimer Kenner – auch der spieltechnischen Schwierigkeiten der Werke – sich anschickt, die besondere Bedeutung des Phänomens Reger zu erschliessen. Der Organist und Theologe Hans-Peter Retzmann hat Eine Studie zu Regers Musikdenken vorgelegt, in der er die wesentlichen Eigenarten von Regers Komponieren und dessen musikalische «Haltung» erkundet. Dabei stützt er sich auf Selbstaussagen des Komponisten, die in einer Vielzahl von Briefen überliefert sind, vor allem aber auf die (Orgel-)Werke selbst. Ausgehend von Regers eigenem Begriff der «harmonischen Melodie» prägt Retzmann weitere Vokabeln, mit denen Regers kompositorische Verfahren und ästhetischen Zielsetzungen zu fassen sind: emanzipierte Linie, expressive Felder, Miniaturisierung, emotionale Innen-Anbindung, musikalische Chiffrierung, Mosaik-Zellentechnik, Werk-Entgrenzung. Ob sich diese Begriffe im künftigen Diskurs behaupten werden, muss die weitere Forschung weisen. Besonders erhellend sind die Bemerkungen zu Regers Bach-Rezeption, zu seiner alternativen Position in den damaligen Auseinandersetzungen zwischen Programm- und absoluter Musik wie auch zur grundsätzlichen Offenheit von Regers ausdrucksstarker, aber eben nicht inhaltlich gebundener Musiksprache.
Angesichts der Komplexität des Gegenstandes besteht die Gefahr, begriffliche Setzungen nicht restlos abzusichern und die einmal gewonnenen Vokabeln eher durcheinanderzuwirbeln, als sie stringent zueinander in Beziehung zu setzen. Dieser Gefahr ist auch Retzmann nicht entgangen, denn für ihn wichtige Begriffe wie «disparat» (ab S. 51), «parametrische Zelle» (ab S. 112), «transgressives Verhalten» und «Valenzen» (ab S. 294) sowie «integrale Transformation» (ab S. 311) werden nicht genügend fundiert bzw. sind nicht völlig treffsicher gewählt. Möglicherweise wollte der Autor auch zu viel: Seine zusätzlichen Bemerkungen zur Rezeption von Regers Musik, zu Albert Schweitzers Überlegungen zu orgel-stilistischen Fragen wie schliesslich auch zur Interpretation der Orgelwerke sprengen den Rahmen seines Vorhabens und vernebeln seine zentralen Erkenntnisse und Postulate. Was dem Buch fehlt, ist ein kritisches Lektorat, das den Autor sowohl in der Anordnung der Gedanken wie auch in der Behebung sprachlicher Mängel beraten hätte. Zahlreiche Druck-, Formatierungs- und Formulierungsfehler vermitteln den Eindruck, dass die imposante und durchaus anregende Studie letztlich Entwurf geblieben ist.
Hans-Peter Retzmann, Max Regers Musik. Eine Studie zu Regers Musikdenken, (=Quellen und Studien zur Musikgeschichte von der Antike bis in die Gegenwart, hg. von Michael von Albrecht und Eliott Antokoletz, Band 44), 364 S., Fr. 76.00, Peter Lang, Bern u.a. 2015