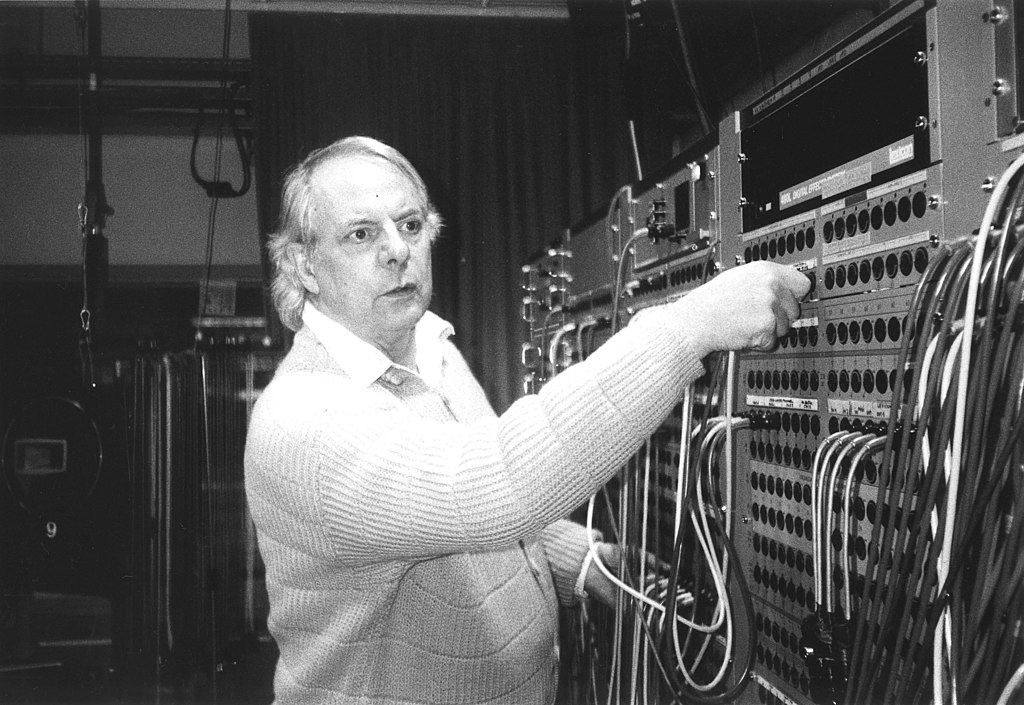Über Kodálys Kammermusik
Ein deutsches Buch über Zoltán Kodály ist ohnehin selten. Hier ist es zudem ganz seiner Kammermusik gewidmet. – Hoffentlich ein Anstoss für das eine oder andere Ensemble, sie auf das Programm zu setzen.
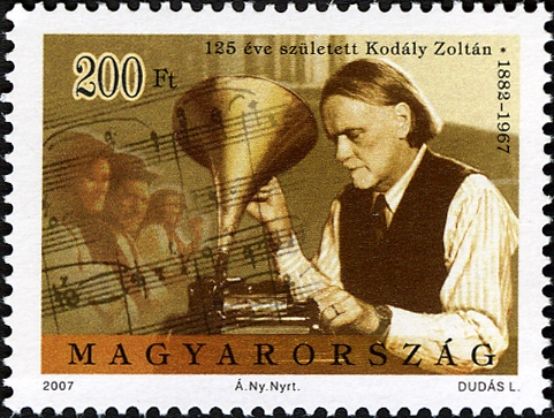
Überblickt man die 57 Bände der Reihe Studien zur Wertungsforschung, staunt man über die Vielfalt der Themenbereiche, wundert sich aber oft auch darüber, dass viele der Erkenntnisse kaum über den Tellerrand der Wissenschaften hinaus gelangen, bis zu den Musikern und Konzertgängern, die ja als deren «Konsumenten» angesehen werden könnten. Da es sich jedoch in den meisten Fällen um die gesammelten Vortragsmanuskripte aus Symposien handelt, deren Sprache bisweilen einem Fachjargon entspricht, müssten sie für Laien «übersetzt» werden. Und so ist es ein weiter Weg bis zu den Interpreten und dann zu den Konzerteinführungen.
Im vorliegenden Band zur Kammermusik des ungarischen Komponisten Zoltán Kodály (1882–1967) sind aber alle Texte in einem erfreulich lesbaren Stil verfasst. Ausserdem sind umfangreiche Partiturbeispiele eingefügt, sodass ein «Mitlesen» im Notenbild den Zugang zu den besprochenen Aspekten erleichtert. Die Cellosonate op. 4 wird von Hartmut Schick unter dem Blickwinkel der Quarte betrachtet, deren Behandlung die Schwelle zur Neuen Musik bildet. Roswitha Schlötterer-Traimer zeigt Volksmusikelemente im ersten und zweiten Streichquartett auf, László Vikárius in der Cello-Solosonate op. 8. Bei Michael Kube steht das Streichquartett op. 2 mit der Rezeption und den Druckausgaben im Mittelpunkt, bei Anna Dalos das Streichquartett op. 10, wobei hier die Zeit des Ersten Weltkriegs mit hineinspielt.
Verdienstvoll ist es, dass der Platz Zoltán Kodály allein gehört (ohne den üblichen Bezug auf Bartók) und dass auch die gesellschaftlich-politische Seite der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg – Kodálys Budapest um 1900 – von Ilona Sármány-Parsons ausführlich dargestellt wird. Thomas Kabisch und Klaus Aringer behandeln die beiden ungewöhnlich besetzten Werke Opus 7 (Duo für Violine und Cello) und Opus 12 (Serenade für 2 Violinen und Viola). Somit werden einige Kompositionen vorgestellt, die ganz selten in die Kammermusikprogramme unserer Tage gelangen. Eine solche Publikation könnte bei Musikern den Namen Zoltán Kodálys in Erinnerung rufen und diesem Mangel abhelfen. Deutschsprachige Literatur ist so rar, dass sogar das kleine Buch mit den fünf Gesprächen, die Lutz Besch mit Kodály geführt hat, mehrfach erwähnt wird (Verlag Arche, Zürich 1966).
Zoltán Kodálys Kammermusik, Studien zur Wertungsforschung 57, hg. von Klaus Aringer, 239 S., brosch., € 28.50, Universal Edition, Wien 2015, ISBN 978-3-7024-7283-2